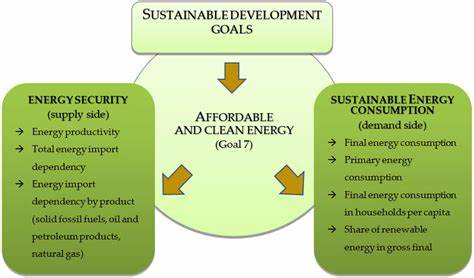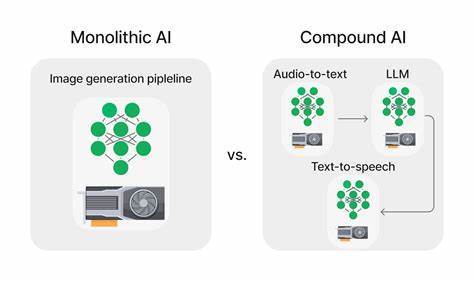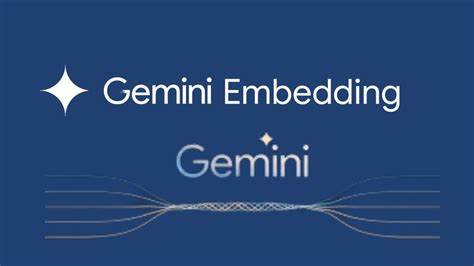Die Energiewende ist eine der wichtigsten Herausforderungen und Chancen unserer Zeit. Um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, müssen fossile Energieträger durch nachhaltige, regenerative Energiequellen ersetzt werden. Windkraft, Photovoltaik und andere erneuerbare Technologien bieten wirtschaftlich wettbewerbsfähige Möglichkeiten, um eine klima- und ressourcenschonende Energieversorgung zu gewährleisten. Doch trotz sinkender Kosten und technologischem Fortschritt verlangsamt sich der Ausbau besonders in Deutschland – und ein wesentlicher Grund dafür liegt im Widerstand vor Ort. Der Hauptkritikpunkt vieler Bürgerinnen und Bürger betrifft die Sichtbarkeit der Anlagen, insbesondere großer Windräder oder großflächiger Solarfelder, die als Störung ästhetisch wertvoller Landschaften wahrgenommen werden.
Im Bereich der erneuerbaren Energien stellt sich damit die Herausforderung, wie die Sichtbarkeit solcher Anlagen auf landschaftlich und gesellschaftlich sensiblen Gebieten begrenzt werden kann, ohne die Systemkosten und die Versorgungssicherheit unverhältnismäßig zu erhöhen. Eine neue umfassende Studie liefert spannende Erkenntnisse zu diesem Dilemma. Mittels eines innovativen Ansatzes, der sogenannte umgekehrte Sichtbarkeitsanalysen („reverse viewshed analysis“), wurde deutschlandweit untersucht, welche Flächen für Wind- und Photovoltaik-Anlagen geeignet sind, wenn diese nicht von besonders schönen oder dicht besiedelten Regionen aus sichtbar sein sollen. Die Studie kombiniert geographische Sichtbarkeitsmodelle mit techno-ökonomischen Analysen des Energiesystems und ermöglicht so, den Einfluss von Sichtbarkeitsrestriktionen auf das Potenzial erneuerbarer Energien, die Struktur des Energiesystems sowie die Systemkosten bis 2045 zu quantifizieren. Die Methode unterscheidet sich deutlich von herkömmlichen Sichtbarkeitsanalysen.
Während klassische Ansätze meist vom Standort der geplanten Anlage ausgehen und prüfen, aus welchen Blickrichtungen sie sichtbar sein werden, wird hier der Blickwinkel umgedreht: Es wird vom Ort der zu schützenden Landschaft oder Ansiedlung aus berechnet, in welchen Bereichen der Bau neuer Anlagen sichtbar wäre. Diese sogenannten „reverse viewsheds“ erlauben eine prospektive Planung, die weder einzelne Projekte noch Standorte voraussetzt. 357.588 Punkte – jede Kilometerquadratfläche in Deutschland – wurden als mögliche Beobachtungspunkte verwendet, inklusive deren sogenannter „scenicness“-Bewertung, also der ästhetischen Qualität der Landschaft, sowie der Bevölkerungsdichte. So konnte flächendeckend dargestellt werden, wo Anlagen aus besonders wertvollen oder dicht besiedelten Zonen heraus sichtbar wären und dementsprechend Flächen für den Bau ausgeschlossen werden können.
Die Ergebnisse zeigen ein differenziertes Bild: Werden ausschließlich Sichtbarkeitsrestriktionen für die landschaftlich schönsten oder am dichtesten besiedelten Gebiete berücksichtigt, reduziert sich das Potenzial an geeigneten Flächen für Onshore-Windkraftanlagen nur moderat. Konkret bedeutet das, dass bei einer Exklusion von Anlagen, die aus den Bereichen mit höchster scenicness-Stufe (Skala bis 9) oder einer sehr hohen Bevölkerungsdichte (≥ 5000 Einwohner je km²) sichtbar sind, das Kapazitätspotenzial für Windenergie etwa um 10 Prozent geringer ausfällt. Bei Photovoltaik ist die Reduktion noch geringer, da Solaranlagen in der Regel einen weniger stark störenden Einfluss auf das Landschaftsbild ausüben. Erst bei weit strengeren Kriterien, die etwa alle Flächen ausschließen, von denen Anlagen auch aus durchschnittlich schönen oder mittelmäßig dicht besiedelten Bereichen sichtbar wären, kristallisiert sich eine massive Reduktion des Potenzials heraus. In solchen Szenarien bleiben bei Windkraft nur geringe Reste an geeigneten Flächen übrig, die rund 99 Prozent des ursprünglichen Potenzials ausmachen.
Bei Photovoltaik sinkt das mit hohen Sichtbarkeitsanforderungen noch verbleibende Potenzial zwar nicht so dramatisch, aber ebenfalls deutlich. Offshore-Windkraft hingegen wird von solchen Sichtbarkeitsfragen weniger tangiert, da sich Windparks dort ohnehin weit vom Land entfernt befinden und gesetzlich mindestens 15 Kilometer Abstand zur Küste einhalten müssen – was deutlich über den angenommenen Sichtbarkeitsradius von 11 Kilometern hinausgeht. Diese Einschränkungen wirken sich direkt auf den weiteren Verlauf der Energiewende und deren Wirtschaftlichkeit aus. Die Studie nutzt für die Analyse der Energiesystemkosten ein hochdetailliertes Optimierungsmodell, das alle relevanten Sektoren berücksichtigt. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass moderate Sichtbarkeitsrestriktionen – also das Vermeiden von Anlagen in den schönsten oder sehr dicht besiedelten Gebieten – kaum einen Einfluss auf die Gesamtkosten bis 2045 haben.
Die Kostensteigerungen bleiben wirtschaftlich und fallen im Rahmen marktüblicher Unsicherheiten. Das bedeutet für die Politik und Gesellschaft, dass es möglich ist, Rücksicht auf die landschaftlichen und sozialräumlichen Belange zu nehmen, ohne die Energiewende unverhältnismäßig zu verteuern. Anders sieht es aus, wenn die Anforderungen an die Unsichtbarkeit sehr strikt werden. Die alltägliche Sichtbarkeit großer Anlagen soll auf ein Minimum reduziert werden, selbst aus durchschnittlich bewerteten Landschaften und Ortschaften. In diesen Fällen steigen die jährlichen Gesamtkosten des Energiesystems um bis zu 38 Prozent im Vergleich zum Basisfall ohne zusätzliche Einschränkungen.
Diese Mehrkosten entsprechen vielen Milliarden Euro pro Jahr. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Aufgrund der stark begrenzten Flächen für Onshore-Wind und offene Solarfelder müssen der Ausbau konzentriert in Offshore-Anlagen und auf Dachflächen verlagert werden – der Zubau an Dach-Photovoltaik würde sich in der Folge fast verachtzehnfachen. Dabei liegen große Herausforderungen vor allem in der Realisierung eines solch rasanten Ausbaus von Dach-PV. Aktuelle Wachstumsraten müssten drastisch gesteigert werden, um den Bedarf zu decken.
Zudem schaffen soziale und ökonomische Hemmnisse, wie hohe Anfangsinvestitionen oder unklare Eigentumsverhältnisse bei Mietwohnungen, weitere Hürden. Neben dem verstärkten Einsatz von Offshore-Wind und Dach-PV nimmt in den restriktiven Szenarien auch der Import von grünem Wasserstoff stark zu. Größtenteils kann Deutschland die Wasserstoffproduktion dann nicht mehr ausschließlich durch heimische Erneuerbare decken. Die Abhängigkeit vom Ausland steigt und mit ihr potentielle geopolitische Risiken sowie der Vorwurf von „Carbon Leakage“ – also das Verlegen von Emissionen ins Ausland. Die Importe von grünem Wasserstoff bedeuten zudem zusätzliche Kosten und werfen Nachhaltigkeitsfragen auf, da die Herstellung des Wasserstoffs in anderen Ländern nicht immer mit den gleichen ökologischen Standards verbunden ist.
Die Studie macht deutlich, dass der Versuch, eine vollständige „Unsichtbarkeit“ von erneuerbaren Energieanlagen aus möglichst vielen Regionen zu gewährleisten, zwar aus gesellschaftlicher Perspektive verständlich sein mag, aber ökonomisch und energetisch eine sehr hohe Belastung bedeutet. Die aufwändige Abwägung zwischen Schutz des Landschaftsbildes und Kosteneffizienz muss daher mit anderen Ansätzen zur Erhöhung der Akzeptanz kombiniert werden. Wichtig ist dabei auch, dass die Sichtbarkeit nicht immer strikt negativ wahrgenommen wird. Für viele Menschen symbolisieren Windräder und Solaranlagen Fortschritt und nachhaltiges Handeln, positive Identifikations- und Zukunftsbilder sind ebenfalls dokumentiert. Ebenso zeigen Erfahrungen, dass Konflikte oft nicht die Mehrheit der Bevölkerung betreffen, sondern von engagierten Minderheiten getragen werden.
Akzeptanz basiert somit auf komplexen sozialen Dynamiken, die weit über den rein visuellen Eindruck hinausgehen. Die vorgestellte Methodik der Reverse-Viewshed-Analyse bietet politische Entscheidern und Planungsbehörden ein äußerst wertvolles Werkzeug. Sie können damit schon zu Beginn der Planung kommunal relevante sensitivitätszonen identifizieren und Ausschlussbereiche für erneuerbare Infrastruktur definieren, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Landschaftsschutz und Energiewende ermöglichen. Die geographisch differenzierten Analysen zeigen, dass es in Deutschland durchaus zahlreiche Standorte gibt, die weder aus besonders empfindlichen landschaftlichen Sichtpunkten noch aus Ballungszentren sichtbar wären, und an denen kosteneffizient erneuerbare Anlagen errichtet werden können. Die Nutzung solcher „No-Regret“-Flächen kann helfen, Konflikte zu minimieren und gleichzeitig den notwendigen Ausbaupfad einzuhalten.
Für zukünftige Untersuchungen und Planungen wäre es sinnvoll, diesen Ansatz auf weitere Länder mit unterschiedlichen Landschafts- und Bevölkerungsverteilungen zu übertragen. Auch eine Kopplung mit partizipativen Verfahren und stärkere Berücksichtigung dynamischer Akzeptanzfaktoren könnten den Planungsprozess verbessern. Schließlich sollten auch optische Auswirkungen von Stromnetzausbau und anderen Infrastrukturmaßnahmen in zukünftige Modelle integriert werden, um ein vollständigeres Bild der Wechselwirkungen zu erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die klare Berücksichtigung der visuellen Belastungen erkennbar zur Akzeptanzsteigerung an der lokalen Ebene beiträgt und somit für eine sozialverträgliche Energiewende unerlässlich ist. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass eine Komplettunsichtbarkeit mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten und großen Herausforderungen für die Energiewende verbunden wäre.
Eine sinnvolle Balance zwischen Sichtbarkeitsschutz und wirtschaftlicher Machbarkeit ist daher notwendig – diese Studie zeigt erste Wege auf, wie diese Balance methodisch fundiert erkannt und politisch umgesetzt werden kann. Die Energiewende ist nicht nur eine technologische, sondern vor allem eine gesellschaftliche Herausforderung, die Planung und Partizipation gleichermaßen erfordert, um erfolgreich und nachhaltig gestaltet zu werden.