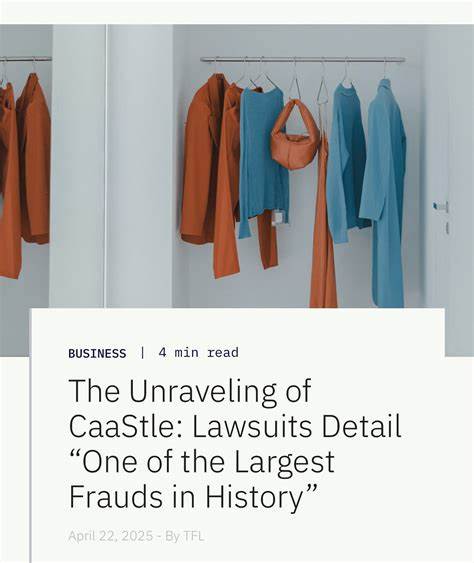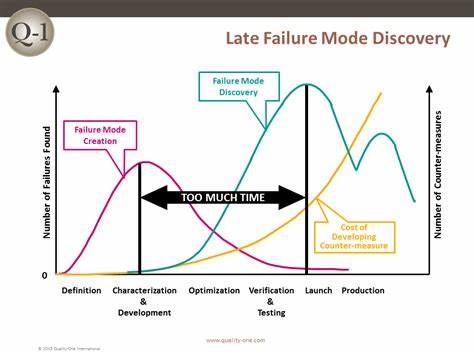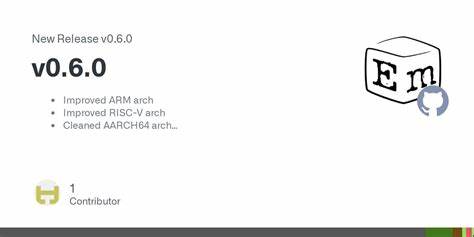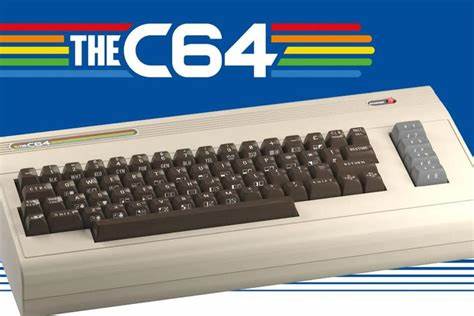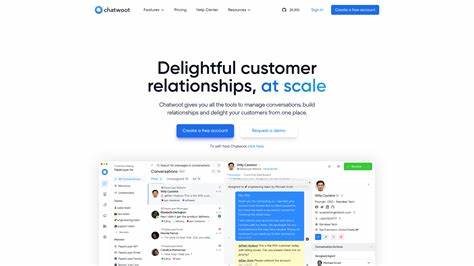Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit seinem Urteil zum Ende des sogenannten „Goldene-Pässe“-Programms in Malta eine bedeutende Entscheidung getroffen, die weitreichende Auswirkungen auf die EU-Mitgliedsstaaten und deren Umgang mit Staatsbürgerschaftsvergaben haben wird. Seit vielen Jahren bietet Malta wohlhabenden Ausländern die Möglichkeit, sich durch Investitionen eine maltesische Staatsbürgerschaft zu sichern. Diese Praxis, die als „Goldene-Pässe“ bekannt ist, wurde wiederholt kontrovers diskutiert. Nun steht fest: Die Kommerzialisierung von EU-Staatsbürgerschaften verstößt gegen EU-Recht und darf nicht länger fortgeführt werden. Das Urteil des EuGH markiert ein deutliches Signal dafür, dass die Staatsbürgerschaft innerhalb der Europäischen Union kein Handelsgut sein darf.
Die Richter betonten, dass eine Staatsbürgerschaft nicht einfach durch eine finanzielle Transaktion erworben werden kann. Vielmehr muss sie auf einem echten Band von Solidarität, Vertrauen und gegenseitiger Verpflichtung zwischen dem Mitgliedsstaat und dem Bürger beruhen. Das Gericht wies Malta ausdrücklich darauf hin, dass das Programm nicht nur gegen EU-Gesetz verstößt, sondern auch gegen Grundprinzipien der Zusammenarbeit und Vertrauensbildung unter den Mitgliedstaaten. Seit 2015 konnte Malta durch sein Investorenprogramm rund 1,4 Milliarden Euro an Einnahmen generieren. Trotz dieses erheblichen finanziellen Nutzens wurde das Programm von vielen Seiten kritisiert.
Kritiker sehen in den „Goldenen Pässen“ ein Tor für Kriminalität, Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen. Besonders in den letzten Jahren rückte das Problem in das Zentrum der Aufmerksamkeit, da vor allem russische und belarussische Staatsbürger, die von westlichen Sanktionen betroffen sind, auf diese Weise Zugang zur EU erhalten konnten. Die politische und sicherheitspolitische Brisanz dieser Praxis wurde durch den russischen Angriff auf die Ukraine zusätzlich verschärft. Der EuGH folgte damit Forderungen von Transparenz- und Antikorruptionsorganisationen sowie zahlreichen EU-Institutionen, die schon seit Jahren auf eine Abschaffung solcher Programme drängen. Die Europäische Kommission hatte bereits seit 2020 rechtliche Schritte gegen Malta und Zypern eingeleitet, da diese Länder als letzte in der EU derartige Bürgerschaftsverkäufe praktizierten.
Zypern hatte sein Programm bereits 2021 beendet, Bulgarien folgte 2022. Malta war damit einer der letzten verbliebenen Staaten, die das Prinzip der Staatsbürgerschaft als handelbares Gut verteidigten. Neben dem rechtlichen Urteil löste die Entscheidung in Malta politisch und gesellschaftlich kontroverse Reaktionen aus. Die maltesische Regierung signalisierte Respekt vor dem Urteil, plant aber gleichzeitig eine genaue Prüfung der rechtlichen Konsequenzen. Frühere Regierungsvertreter verteidigten das Programm und bezweifelten die Neutralität des EuGH, wobei die Forderung laut wurde, das Programm statt seiner abschließenden Aufhebung zu reformieren.
Auf der anderen Seite begrüßten maltesische Journalisten und Vertreter der Zivilgesellschaft das Urteil als entscheidenden Sieg gegen Korruption und Missbrauch. Historisch gesehen waren „Goldene-Pässe“- und „Goldene-Visa“-Programme in Europa und darüber hinaus in den Jahren nach der Finanzkrise 2008 sehr verbreitet. Viele Staaten sahen darin eine Möglichkeit, dringend benötigte Investitionen und Kapital in ihre Wirtschaft zu holen. Über die Jahre häuften sich jedoch Berichte über Schattenseiten dieser Programmatik. Beschwerden reichten von negativen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, die zu einer Verschärfung der Immobilienpreise in beliebten Lagen führten, bis hin zu mitunter unzureichenden Kontrollen der Bewerber, die in einigen Fällen kriminelle Verstrickungen hatten.
Die Sicherheitsbedenken wurden durch Ereignisse wie den Anschlag von Salisbury 2018 in Großbritannien verstärkt, der die Verwundbarkeit von EU-Staaten gegenüber verdeckten Bewegungen fragwürdiger Akteure eindrücklich zeigte. Seitdem stieg der Druck in Brüssel, solche Programme stärker zu regulieren oder ganz abzuschaffen. Die Erfolge des EuGH-Urteils könnten die weiteren Abschaffungen ähnlicher Programme in Europa beschleunigen und verbindliche Standards für die Vergabe von Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechten festlegen. Darüber hinaus wirft der Fall wichtige Fragen über die Zukunft der europäischen Integration, des Binnenmarktes und der gemeinsamen europäischen Werte auf. Staatsbürgerschaft ist eine der zentralen Säulen der EU und verbindet Rechte, Pflichten und eine politische Zugehörigkeit, die den Mitgliedstaaten und ihren Bürgern eine besondere Solidarität abverlangt.
Die Kommerzialisierung dieses Rechts stellt eine Erosion dieser Grundwerte dar. Das Gericht hebt hervor, dass bei einer Union von 27 Mitgliedstaaten gegenseitiges Vertrauen essenziell ist, um das tägliche Zusammenleben und die Zusammenarbeit der Staaten zu gewährleisten. Ein Geschäftsmodell, das die Staatsbürgerschaft als Ware betrachtet, gefährdet dieses Vertrauen erheblich. Das Urteil könnte auch internationale Nachwirkungen haben, da Programme ähnlicher Art auch in anderen Teilen der Welt existieren und dort zunehmend auf Kritik stoßen. Gleichzeitig lenkt das Thema den Blick auf die komplexen Herausforderungen der Migration, Integration und Sicherheit in einer globalisierten Welt.
Die EU versucht, sich hier durch gemeinsame Regeln und Kontrollmechanismen abzugrenzen, stößt jedoch immer wieder auf nationale Interessen und wirtschaftliche Erwägungen. Gleichzeitig wurde das Thema durch den kürzlich angekündigten Plan von US-Präsident Donald Trump, ein eigenes vergleichbares „Gold Card“-Programm mit Anbindung an den US-Staatsbürgerschaftserwerb zu starten, in den transatlantischen Fokus gerückt. Diese Entwicklung wirft weitere Debatten über die Ethik und die Sicherheit solcher Bürgerrechtsprogramme auf und fordert ein Umdenken im weltweiten Umgang mit Staatsbürgerschaft und Migration. Unabhängig von Maltas Entscheidung ist die Abschaffung der „Goldene-Pässe“-Programme ein Schritt in Richtung mehr Transparenz, Sicherheit und Integrität innerhalb der EU. Die Mitgliedstaaten sind nun stärker gefordert, alternative Wege zu finden, um Investitionen zu fördern, ohne die Einheit und die Werte des europäischen Projekts zu gefährden.
Das EuGH-Urteil sendet ein klares Signal, dass kommerzielle Interessen nicht über fundamentalem Recht und gegenseitigem Vertrauen stehen dürfen. Auf Malta selbst und andere EU-Staaten kommt nun eine entscheidende Phase der Anpassung ihrer Gesetzgebung und Praktiken zu. Die Implementierung des Urteils wird zeigen, wie konsequent und wirksam die EU ihre Prinzipien durchsetzen kann. Zudem werden sich weitere Fragen stellen: Was passiert mit bereits ausgestellten Pässen? Wie können künftige Investoren und Bürger besser kontrolliert und integriert werden? Und vor allem, wie kann die EU die Balance zwischen wirtschaftlicher Offenheit und rechtlicher Sorgfalt weiterhin gewährleisten? Abschließend unterstreicht das Urteil des EuGH, dass European citizenship einen hohen Wert besitzt, der über rein finanzielle oder kurzfristige Vorteile hinausgeht. Staatsbürgerschaft ist ein Fundament für Teilhabe, Rechtsstaatlichkeit und Gemeinschaft.
Die Entscheidung ist eine Mahnung an alle EU-Mitgliedsstaaten, den Schutz dieser Werte an erste Stelle zu setzen und verantwortungsbewusst mit der Vergabe von Bürgerrechten umzugehen. Malta mag als erster Staat von diesem Programm Abschied nehmen, doch der Impuls zur Reform wird weit in alle Länder der Union hineinwirken und die europäische Integrationspolitik nachhaltig prägen.