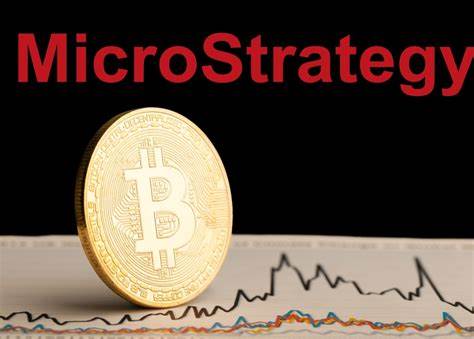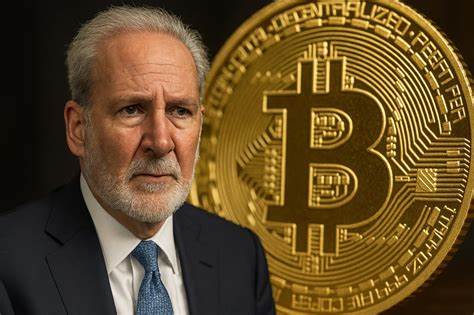Im Jahr 2014 sorgten Enthüllungen rund um geheime Absprachen zwischen Technologieriesen wie Apple und Google für Aufsehen. Besonders im Fokus stand eine Episode aus dem Frühjahr 2006, als Google um die Erlaubnis von Steve Jobs bat, ehemalige Apple-Ingenieure in ihrem neu geplanten Pariser Büro anstellen zu dürfen. Dieses außergewöhnliche Nachfrage- und Genehmigungsverfahren verdeutlicht die dominante Rolle, die Jobs in der Branche spielte – weit über sein eigenes Unternehmen hinaus. Ebenso offenbart es, wie durch solche Absprachen Innovationen im Silicon Valley erheblich gebremst wurden. Die Geschichte beginnt mit Jean-Marie Hullot, einem hochrangigen und bei Apple sehr geschätzten Programmierer, der seit den Tagen von NeXT an der Seite von Steve Jobs arbeitete.
Nach seinem Rücktritt bei Apple Ende 2005 verließ Hullot die Firma zusammen mit einem Team von vier Ingenieuren. In den Monaten darauf führte Hullot Verhandlungen mit Google, um ein Ingenieurbüro in Paris aufzubauen. Trotz der Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses mit Apple warteten alle Beteiligten auf das „Go“ von Steve Jobs, bevor sie endgültig den Schritt wagten. Diese außergewöhnliche Bitte um Zustimmung illustriert eine stille Übereinkunft zwischen Apple und Google, die sowohl die Wettbewerbsfähigkeit als auch die Arbeitsmärkte beeinflusste. Google schickte am 28.
März 2006 eine E-Mail von Alan Eustace, einem der führenden Ingenieursmanager bei Google, direkt an Jobs und die Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin. Darin bat Eustace höflich und mit hoher Wertschätzung um Jobs’ Zustimmung, bevor sie das Team von Hullot anstellten. Die Rolle von Bill Campbell, einem wichtigen Berater beider Unternehmen, unterstrich die Vernetzungen zwischen Apple und Google noch weiter. Steve Jobs reagierte zunächst nicht sofort auf die Anfrage und ließ Interessenten mehrere Wochen im Ungewissen. Währenddessen wartete Hullot mit seiner Familie auf eine Antwort, die über ihre berufliche Zukunft entschied.
Dieses Zögern veranschaulicht, wie tief die Abhängigkeit und Angst vor Konflikten innerhalb dieser Spitzenpositionen verankert waren. Als Jobs schließlich antwortete, war seine Botschaft eindeutig und ablehnend: Er wollte nicht, dass Google ehemalige Apple-Ingenieure einstellte, speziell jene, die in Bereichen wie Mobiltelefonen arbeiteten – einer der Kernbereiche, in denen sowohl Apple als auch Google mächtige Positionen einnahmen. Die klare Ablehnung setzte ein deutliches Zeichen, dass solche Einstellungen als Bedrohung gesehen wurden und unter keinen Umständen geduldet werden sollten. Interessant dabei ist die Reaktion von Google, die verstärkte Bemühungen zeigte, keine Projekte zu verfolgen, die mit Apple konkurrierten oder in Konflikt gerieten. Trotz aller Innovationsenergie des Tech-Giganten mussten sie sich der Einmischung von Jobs beugen und den Ausbau ihres Pariser Büros mit dem Team von Hullot ablehnen.
Die Absage wurde dabei als eine Notwendigkeit gesehen, um die fragile aber strategisch wichtige Beziehung zu Apple nicht zu gefährden. Diese Episode offenbart das dunkle Kapitel der sogenannten „Techtopus“-Konspiration, bei der mehrere Tech-Unternehmen heimliche Absprachen trafen, um Löhne niedrig zu halten und den Talentwettbewerb zu unterbinden. Anstatt den Wettbewerb um die besten Köpfe zu fördern, sorgten diese geheimen Non-Poaching-Absprachen für eine künstliche Stabilisierung der Gehaltsstrukturen und schränkten den Innovationsfluss massiv ein. Der Fall von Hullot illustriert, wie Jobs seine persönliche Autorität nicht nur zur Innovationsförderung, sondern auch als Hebel zur Kontrolle der Konkurrenz nutzte. Googles Bereitschaft, Projektideen Jobs zur Prüfung vorzulegen, verdeutlicht die Machtstruktur, die in dieser Phase der Tech-Industrie herrschte.
Langfristig hat diese Praxis dem Fortschritt keinen Dienst erwiesen. Vielmehr verlagerte sich das Talent zögerlich, und Innovationen wurden durch solche Machtspiele eingeschränkt. Experten und Insider argumentierten, dass Wettbewerb Innovation antreibt, doch das Gegenteil trat ein, als sich Branchenführer gegenseitig ein „Vetorecht“ über Talente gaben. Als Reaktion auf diese Enthüllungen wurden Apple, Google und weitere Firmen in einem Gehalts-Festsetzungsverfahren verklagt, das die Praktiken kritisch beleuchtete und Konsequenzen für fairere Arbeitsmärkte forderte. Sergey Brin, einer der Google-Mitgründer, bemerkte in einer Zeugenaussage, dass Jobs’ Sichtweise darauf beruhte, niemanden zu beschäftigen, der ihn verärgern könnte – eine Einschätzung, die zeigt, wie persönlich und emotional die Geschäftsentscheidungen teilweise getroffen wurden.
Nach der Absage durch Jobs begab sich Hullot nicht sofort in ein anderes Technologiefeld, sondern nahm sich Zeit für eine ausgedehnte Reise mit seiner Familie. Erst später kehrte er zurück und konzentrierte sich auf Projekte, die eng mit Apple verbunden waren, wie die Entwicklung von Apps für das iPad. Diese Entwicklung verdeutlicht zudem, wie tief persönliche Beziehungen und Fankulturen um Steve Jobs das berufliche Handeln bedeutender Persönlichkeiten prägten. Die Enthüllung dieses spezifischen Falles war ein bedeutendes Schlaglicht auf die Mechanismen des Wettbewerbs zwischen großen Technologieunternehmen in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts.
Sie zeigte, dass der Innovationskampf nicht nur auf Produktebene, sondern auch auf der Ebene des Talentmanagements ausgetragen wurde. Obwohl die Offenlegung dieser Vorfälle viele Kritiker dazu bewegte, die Praktiken abzulehnen und gesetzliche Veränderungen zu fordern, halten manche Industrievertreter die damaligen Absprachen für beinahe unausweichlich gewesen, um Kontrolle über wichtige Teams zu behalten und Kosten in Grenzen zu halten. Doch der Fall Hullot demonstriert klar, dass diese Wege Innovationen wahrscheinlich eher verhinderten als förderten. Heute, Jahre nach diesen Ereignissen, sind Google und Apple zu weltweit führenden Technologienentwicklern herangewachsen. Die Restriktionen dieser Ära wurden weitgehend aufgebrochen, nicht zuletzt durch Gesetzesinitiativen und einen global gewachsenen Bewusstseinswandel zu faireren Beschäftigungspraktiken.