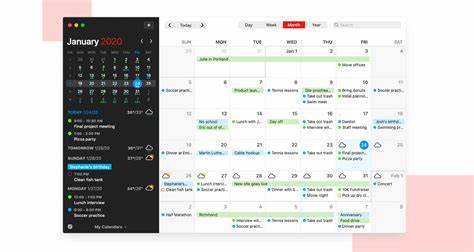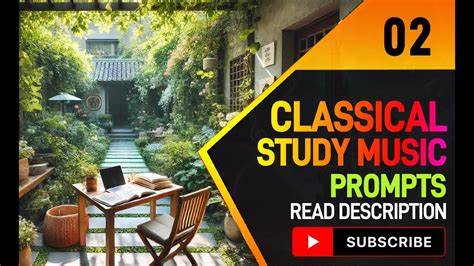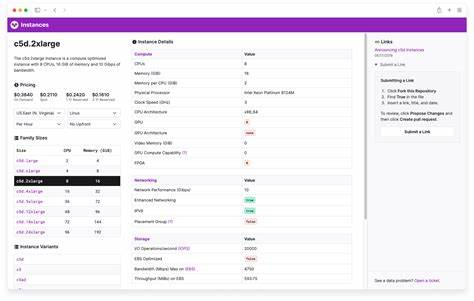World of Warcraft (WoW) ist seit über einem Jahrzehnt eines der populärsten Massive Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPGs) der Welt. In dieser persistenten Online-Welt können Spieler unterschiedliche Rollen annehmen, in komplexen sozialen Strukturen agieren und interaktiv Abenteuer erleben. Doch neben all dem positiven Aspekt gibt es auch eine Schattenseite: die Problematik rund um toxisches Verhalten und besonders um Trash-Talk, der bei manchen Spielern weit über das spielerische Necken hinausgeht und in Missbrauch mündet. Die Grenzen zwischen harmlosem Spott und ernsthaften Beleidigungen oder Belästigungen sind in WoW oft fließend. Diese Problematik wird umso relevanter, da das Spiel eine globale Reichweite besitzt und eine Vielzahl von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Geschlechtsidentität und Erfahrungsniveaus zusammenbringt.
Die Rolle von Online-Identität und Anonymität im virtuellen Raum spielt eine zentrale Rolle in der Entstehung von negativem Verhalten. Die Möglichkeit, sich hinter einem Avatar zu verstecken, schafft eine Distanz zu den Konsequenzen des eigenen Handelns. Avatare sind nicht nur spielerische Figuren, sie sind das Medium, durch das Nutzer ihre Identität ausdrücken oder experimentieren können. Sie erzeugen eine sogenannte technologische „Vervielfältigung“ des Selbst, bei der einzelne Personen verschiedene Identitäten ausprobieren und somit auch Verhaltensweisen annehmen, die sie im realen Leben vielleicht niemals zeigen würden. Für einige kann diese Anonymität eine befreiende Wirkung entfalten und ihre sozialen Kompetenzen stärkend fördern.
Für andere hingegen bietet sie einen Nährboden für aggressive und toxische Verhaltensweisen, die sie im realen Alltag unterdrücken. Das Phänomen des sogenannten „Griefings“ beziehungsweise „Trolling“ ist in WoW ein zentrales Beispiel für solch problematisches Verhalten. Dabei werden Handlungen beschrieben, die gezielt darauf abzielen, andere Spieler zu stören, zu provozieren oder am erfolgreichen Spielen zu hindern. Hierbei reicht die Bandbreite von einfachen Sticheleien bis hin zu ernsthaften Beleidigungen, Belästigungen und systematischem Ausschluss. Einige Spieler greifen zum Beispiel zu Machtspielen innerhalb von Gruppenkontexten wie Raids, in denen einzelne Leitungsrollen, zum Beispiel der Raid-Leader, durch Fehlverhalten negative Dynamiken erzeugen können.
Diese Rollen, die eine gewisse Führungsverantwortung tragen, haben dabei auch die Möglichkeit, andere Spieler durch verbale Aggressionen herabzusetzen und ihre eigene Stellung zu sichern. Besonders auffällig ist dabei, dass unter solchen Umständen der Spielspaß auf der Strecke bleibt und sich die Betroffenen teilweise komplett aus dem Spiel zurückziehen wollen. Ein weiterer Punkt, der in der Wahrnehmung problematischer Kommunikation relevant ist, ist der Faktor Geschlecht. Die Erfahrungen und Wahrnehmungen von toxischem Verhalten unterscheiden sich bei Männern und Frauen signifikant. Frauen berichten häufiger von sexueller Belästigung und abwertenden Kommentaren, die sich nicht nur in den Spielchats zeigen, sondern oft auch über externe Kommunikationskanäle wie Voice-Chat wahrgenommen werden.
Dabei gehört sexistische Sprache und die Reduzierung weiblicher Spieler zu einem wiederkehrenden Problem. Viele weibliche Spieler reagieren auf solche Umstände mit einer Art Abhärtung, da alleinstehende Vorfälle als kaum verhinderbar gelten und mittlerweile fast als „normal“ wahrgenommen werden. Das erschwert es, das Ausmaß und die Tiefe der Problematik zu erkennen, gibt aber auch Einblicke in die Belastung, die viele Spielerinnen durchmachen. Die Männer teilen zwar auch negative Erlebnisse, ihre Wahrnehmung von Aggressionen ist aber häufig subtiler oder in anderen Kontexten verankert. Kritik oder Beleidigungen zielen dann häufig eher auf die Leistung oder das spielerische Können ab.
Die soziale Bedeutung von Männlichkeit und das Wissen um unterschiedliche Geschlechterrollen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Beispielsweise können vulgäre Bemerkungen, die an Frauen gerichtet werden, von männlichen Spielern oft anders eingeordnet oder relativiert werden. Insgesamt gehen alle Beobachtungen in der Forschung dahin, dass soziale Voreingenommenheiten und gesellschaftlich verankerte Rollenbilder die Wahrnehmung von Problemverhalten im Spiel mitprägen. Die Dynamik des Trash-Talks in WoW zeigt sich meist in sogenannten öffentlichen Chat-Kanälen, wie beispielsweise im weltweiten Handelschat. Hier ist der Umgangston häufig rau, geprägt von politischen Debatten, abfälligen Kommentaren und unangemessenen Ausdrücken.
Gerade dieser Raum wird von vielen Spielern als „toxisch“ empfunden, da Minderheiten, wie Frauen oder ethnische Gruppen, häufig Zielscheibe von Kommentaren werden. Für einige Nutzer ist das lediglich unangenehm und empfinden es als „akzeptablen“ Teil des Spiels, während andere dadurch so belastet werden, dass sie sich gezwungen sehen, aus dem Chat oder sogar aus dem Spiel auszusteigen. Die subjektive Wahrnehmung dieser negativen Erfahrungen ist dabei ein entscheidender Faktor. Was der eine als harmlose Neckerei ansieht, kann für einen anderen bereits einen Grenzübertritt in Richtung Mobbing darstellen. Die fehlende Möglichkeit, Körpersprache, Mimik oder Stimmlage zu verifizieren, trägt zur Unsicherheit bei und lässt Missverständnisse schnell entstehen.
Das Fehlen eines direkten sozialen Kontextes und die Anonymität machen es für die Betroffenen schwer einzuschätzen, wie ernst oder böse ein Kommentar gemeint ist. Diese Probleme verstärken sich besonders durch die Online-Interaktion mit fremden Personen außerhalb des eigenen Freundeskreises. Um problematisches Verhalten einzuschränken, bietet World of Warcraft seit jeher Mechanismen zur Melde- und Moderationsfunktion an. Spieler können Beleidigungen, Belästigungen oder anderes unangemessenes Verhalten melden, welches von Community-Managern und dem Entwickler-Studio Blizzard geprüft wird. Dennoch berichten viele Spieler, dass die Reaktion auf solche Meldungen oft unbefriedigend ausfällt.
Besonders im Bereich PvP (Spieler gegen Spieler) wird ein gewisser Grad an Griefing offiziell toleriert, da die Spielmechanik ohnehin Konflikte beinhaltet. Die Grenze zwischen regulärem aggressiven Spielstil und wirklich belästigendem Verhalten ist somit schwer zu ziehen, zum Nachteil der Opfer von Missbrauch. Ein weiterer spannender Aspekt ist das Selbstverständnis der Spieler, die selbst problematisches Verhalten zeigen. Häufig rechtfertigen oder verniedlichen jene Spieler ihr negativerlebnis Auslöser, indem sie ihre Handlung als Reaktion auf Provokation sehen oder aus einer Position der Notwendigkeit heraus erklären. Diese „Kampf oder Flucht“-Reaktion kann aus Frustration oder dem Wunsch, Spielziele zu erreichen, entstehen.
Die Komplexität dieses Verhaltens offenbart sich darin, dass Täter sich selbst nicht immer als solche sehen, sondern oft als Teil eines größeren sozialen Spiels. Dadurch wird auch die Regulierung von problematischem Verhalten erschwert. Die Untersuchung von persönlichen Erfahrungen sowohl als Opfer als auch als Täter bietet wertvolle Einblicke in die soziale Mechanik von WoW. Spieler machen deutlich, dass Wahrnehmung und Kontext entscheidend sind, wenn es darum geht, Verhalten als toxisch oder akzeptabel einzuordnen. Zudem spielt die Dauer und Intensität des negativen Verhaltens eine wichtige Rolle: Kurzzeitige Provokationen werden eher noch als Teil des Spiels akzeptiert, während anhaltende Belästigungen die Grenze zur Unzumutbarkeit überschreiten.
Hier spiegeln sich auch Alltagserfahrungen wider, denn auch im realen Leben beeinflussen Zeit und Schwere von Konflikten die persönliche Wahrnehmung. Interessanterweise berichten Spieler, dass sich das Klima in der World of Warcraft-Gemeinschaft im Laufe der Jahre verschlechtert hat. Anfangs herrschte eine freundlichere Grundstimmung, was teilweise der Neuheit des Spiels und der gemeinsamen Lernerfahrung geschuldet war. Mit der Zeit führten wachsender Wettbewerb, neue Spielmechaniken und exklusive Inhalte allerdings zu einer stärker ausgeprägten Elitismus-Kultur. Schadensbegrenzung und Optimierung rückten in den Vordergrund, ebenso der soziale Druck, bestimmte Leistungen zu erbringen.
Dies schuf Raum für verbale Aggressionen, Ausgrenzung und Mobbing. Auch der Einfluss gesellschaftspolitischer Diskussionen und kontroverser Themen spiegelt sich vermehrt in den Chat-Kanälen wider und sorgt für angespanntes Klima. Die Zukunft der Untersuchung zu toxischem Verhalten in WoW liegt in der breiteren und differenzierteren Betrachtung von Geschlechterrollen, inklusiveren Perspektiven bei der Probandenauswahl und stärkerer Fokussierung auf unterschiedliche Spielweisen wie PvP, Handel und Rollen- bzw. Sozialspiel. Besonders wichtig erscheint es, auch nicht-binäre Geschlechtsidentitäten und marginalisierte Positionen in die Analyse einzubeziehen, um ein vollständigeres Bild über die Wirkung problematischen Verhaltens zu erhalten.