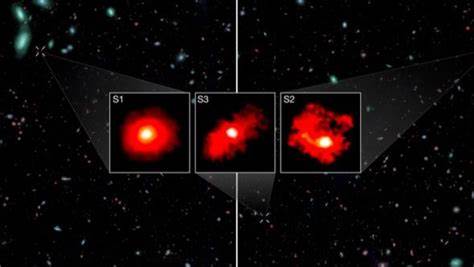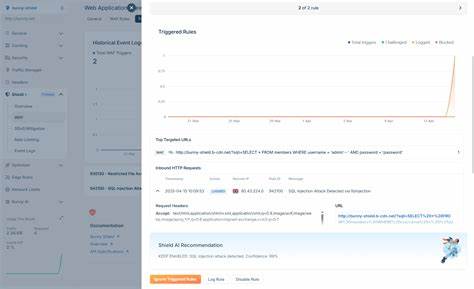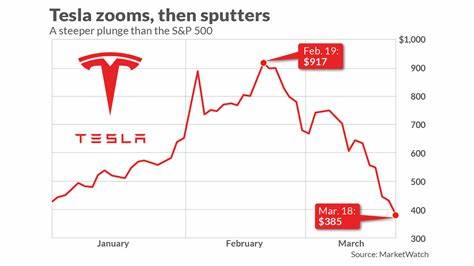In der dynamischen Welt der Softwareentwicklung hat sich die Rolle des Tech Leads in den letzten Jahren grundlegend gewandelt. Lange Zeit galt dieser als Architekt komplexer Systeme, der nicht jeden Codezeile schreiben musste, sich aber in hohem Maße für das Design, die Vision und die Umsetzung einer stabilen und skalierbaren Codebasis verantwortlich zeigte. Das Bild des Tech Leads war das eines Mentors, Strategen und Führungspersönlichkeit zugleich. Heute jedoch scheint dieses Idealbild zunehmend zu verblassen – vielfach bleibt von dieser Rolle nur noch wenig mehr als die Verwaltung von Aufgaben, die im JIRA-Board landen. Die Folge daraus ist eine Art erlernte Hilflosigkeit, die viele Scrum Tech Leads lähmt und sowohl persönliche als auch organisationale Auswirkungen zeitigt.
Dies manifestiert sich darin, dass technische Leitpersonen hauptsächlich als Koordinatoren agieren, die den Fluss von User Stories kontrollieren, Code Reviews verfolgen und versuchen, mit einer Flut oft halb fertiger Anweisungen umzugehen. Die kunstvolle Aufgabe, Architekturen zu formen und systemübergreifende Entscheidungen zu treffen, ist erheblich geschrumpft. Statt selbst die Produktentwicklung maßgeblich zu prägen, wird die Rolle auf das „Reinholen“ und „Abhaken“ von Anforderungen reduziert. Dies führt dazu, dass Tech Leads in einem Zustand verharren, in dem Kompetenz und Verantwortungsgefühl schleichend schwinden – schlicht, weil der Rahmen der Tätigkeit kaum noch Raum dafür bietet, sich weiterzuentwickeln oder strategisch zu arbeiten. Ursächlich für diese Entwicklung ist ein Verschieben der Entscheidungsgewalt und Verantwortung in der Produkt- und Projektentwicklung.
Ursprünglich war die Aufgabenteilung in Unternehmen klar strukturiert: Führungskräfte entwickelten die strategische Ausrichtung, Produktmanager identifizierten Kundenbedürfnisse und echte Chancen, während Entwickler und Designer ihre Kreativität und technisches Know-how einsetzten, um innovative Lösungen zu schaffen. Doch in der Realität vieler moderner Firmen ist dieses harmonische Zusammenspiel meist eher eine Wunschvorstellung. Vielmehr erstreckt sich ein Phänomen, das als Peter-Prinzip bekannt ist, bei dem Führungskräfte dazu neigen, Tätigkeiten auf einem niedrigeren Hierarchielevel auszuführen, womit eine Überlappung von Rollen entsteht. In diesem Szenario werden Entscheidungsbefugnisse von oben nach unten durchgereicht, ohne dass dabei klare Verantwortlichkeiten an der richtigen Stelle liegen. Führungskräfte delegieren konkrete Feature-Anforderungen oft bis ins kleinste Detail an die Produktmanager, die wiederum zunehmend Aufgaben der Systemgestaltung übernehmen, die ihnen nicht zustehen.
Die Tech Leads sehen sich so mit vorgefertigten, detaillierten User Stories und Mikromanagement konfrontiert, das sie entmündigt und sie auf Überwachungs- und Koordinationsrollen reduziert. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, in dem sie sich nicht mehr als kreative Gestalter des Produkts erleben, sondern als bloße Ausführer fremder Vorgaben. Die Psychologie hinter diesem Zustand der erlernten Hilflosigkeit ist bemerkenswert und erschreckend zugleich. Erlernte Hilflosigkeit beschreibt das Phänomen, dass auf Dauer fehlende Kontrolle über Ergebnisse und das Ausbleiben von selbstbestimmtem Handeln dazu führt, dass Individuen ihre Handlungskompetenz und Motivation verlieren. Im Kontext von Tech Leads bedeutet das: Je häufiger sie erleben, dass ihre Expertise und Ideen ignoriert oder ausgebremst werden, desto weniger neigen sie dazu, eigene Impulse einzubringen oder Verantwortung zu übernehmen.
Auf der zwischenmenschlichen Ebene führt dies zu Frustration und einem sinkenden Zugehörigkeitsgefühl gegenüber dem Produkt und Team. Strategische Denkfähigkeit und ganzheitliches Systemverständnis verschwinden zunehmend, da der tägliche Arbeitsfokus stark auf enge, kurzsichtige Aufgaben begrenzt ist. Schließlich entsteht ein Zustand, in dem hohe Gehälter und Positionen kaum noch mit dem erfüllenden Aspekt von technischer und führungskräftiger Arbeit korrespondieren, was wiederum langfristig zu Burnout oder Wechselabsichten führen kann. Ein weiterer Faktor, der zur Verdrängung der ursprünglichen Tech Lead Rolle beiträgt, ist der rasante technologische Wandel im Bereich künstlicher Intelligenz und Automatisierung. Werkzeuge wie GPT-basierte Systeme, intelligente Code-Autoren und automatisierte Testing-Frameworks reduzieren zunehmend den Bedarf an menschlichem Input für standardisierte, repetitive oder sogar komplexe Entwicklungsschritte.
Als Konsequenz können kleinere Start-ups heute MVPs innerhalb kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand realisieren, ohne auf eine Vielzahl von technischen Spezialisten angewiesen zu sein. Dieser technologische Fortschritt liest sich auf den ersten Blick als Vorteil, stellt traditionelle Tech Leads aber gleichzeitig vor die Herausforderung, aus dem reinen Umsetzungsspiel eine aktiv gestaltende Rolle zurückzugewinnen. Während Produktmanager durch den Einsatz von KI-Tools ebenfalls effizienter werden und sogar Aufgaben der Systemgestaltung oder Nutzererlebnisentwicklung eigenständig übernehmen können, fällt die Rolle der technischen Führungskraft, die das große Ganze im Blick behält, umso deutlicher auseinander. Hier stellt sich die Frage, wie Tech Leads sich neu positionieren und welche Kompetenzen sie entwickeln müssen, um weiterhin unverzichtbar und einflussreich zu bleiben. Die Antwort liegt in einem Paradigmenwechsel: Anstatt nur noch JIRA-Tickets abzuarbeiten, sollten Tech Leads wieder die Initiative ergreifen und eine integrative Perspektive einnehmen, die über technische Umsetzung hinausgeht.
Es geht darum, sich wieder als Brückenbauer und Übersetzer wischen strategischem Management, Produktentwicklung und technischer Umsetzung zu sehen. Diese Position erfordert neben technischem Know-how jetzt auch Fähigkeiten im Projektmanagement, Kundenverständnis, Kommunikation und vor allem Empathie, um sowohl Bedürfnisse von Nutzergruppen als auch geschäftliche Prioritäten zu berücksichtigen. Darüber hinaus müssen Tech Leads verstärkt Fähigkeiten in domänenspezifischer Modellierung und Architekturentwicklung aufbauen. In komplexen und stark regulierten Branchen kann künstliche Intelligenz die menschliche Expertise bei der Entwicklung komplexer Systemlandschaften noch nicht ersetzen. Genau hier können erfahrene Tech Leads aktiv wirken, indem sie stabile, modulare Architekturen entwerfen, die langfristige Flexibilität und Skalierbarkeit ermöglichen.
Um dabei nicht den Anschluss zu verlieren, sind kontinuierliche Weiterbildung sowie die Bereitschaft notwendig, neue Technologien und Tools nicht als Bedrohung, sondern als Ergänzung zu begreifen. Dieser Wandel ist für viele Tech Leads mit einer Herausforderung verbunden: Die mentale Überwindung der erlernten Hilflosigkeit. Es bedarf aktiver Reflexion und der Bereitschaft, Verantwortung wieder zu übernehmen und Gestaltungsspielräume einzufordern – sowohl innerhalb des Teams als auch gegenüber der Produkt- und Unternehmensleitung. Eine proaktive Haltung und die Vermittlung des eigenen Wertes sind wichtige Bausteine, um aus der passiven Rolle wieder in eine führende Position zu gelangen. Unternehmen sind ebenfalls gefordert, diese Entwicklung zu unterstützen.
Organisatorische Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass Tech Leads ihr volles Potenzial entfalten können. Das umfasst klare Definitionen von Verantwortlichkeiten, Förderung offener Kommunikation und die Anerkennung von technischem Leadership als strategisch wichtige Funktion. Nur wenn Tech Leads von ihrem Umfeld ermutigt werden, können sie ihre Kompetenzen voll entfalten und aktiv zur Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beitragen. Der Weg aus der erlernten Hilflosigkeit ist demnach ein Weg zurück zur Autonomie, Kreativität und strategischem Einfluss. Tech Leads müssen sich wieder als Mini-CEOs begreifen, die nicht nur technische Leiter, sondern auch Produktgestalter sind.