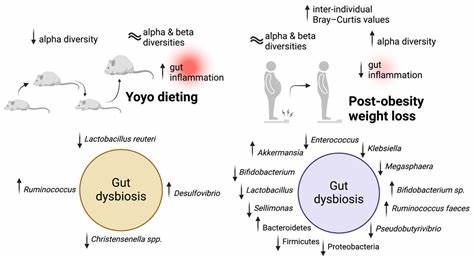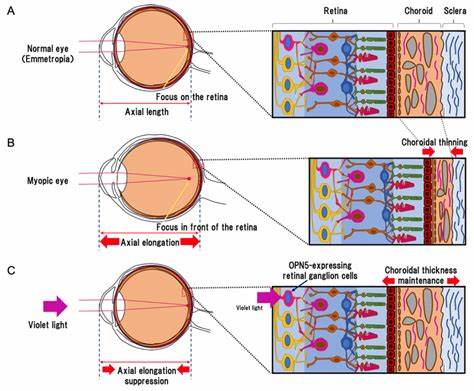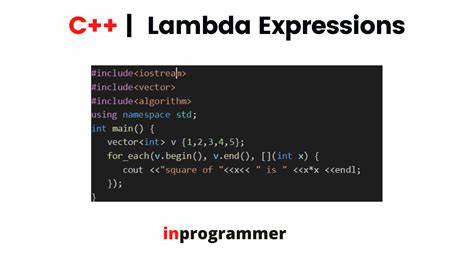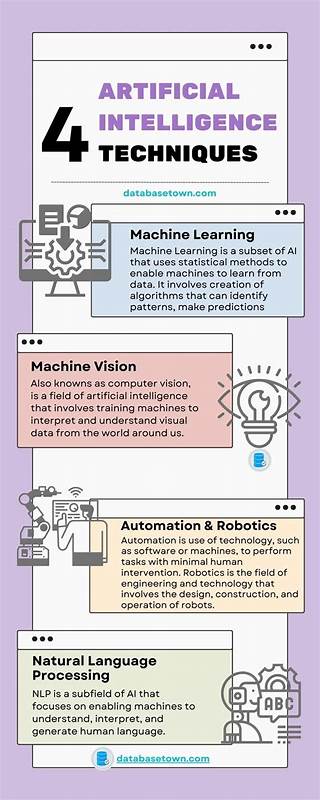In der Tierwelt spielt die soziale Hierarchie eine entscheidende Rolle, wenn es um das Überleben, die Fortpflanzung und die soziale Organisation geht. Bei Mäusen ist die Etablierung und Erkennung eines sozialen Rangs besonders wichtig, um Konflikte zu minimieren und Koexistenz zu fördern. Aktuelle Forschungen am renommierten Francis Crick Institute haben nun gezeigt, dass Mäuse dabei verstärkt auf chemische Signale und Gerüche zurückgreifen, um den Rang eines unbekannten Artgenossen zu erkennen und ihr eigenes Verhalten entsprechend anzupassen. Diese Erkenntnisse bieten interessante Einblicke in die neurobiologischen Mechanismen sozialer Hierarchien bei Säugetieren und geben gleichzeitig spannende Parallelen zum menschlichen Sozialverhalten auf. Mäuse sind gesellig lebende Tiere und zeichnen sich durch eine klare soziale Rangordnung aus.
Innerhalb einer Gruppe übernehmen manche Mäuse dominante Rollen, während andere untergeordnet bleiben. Das Verhalten in solchen Strukturen dient vor allem dazu, unnötige aggressive Auseinandersetzungen zu vermeiden, zugleich aber auch um Ressourcen wie Nahrung und Paarungspartner zu verteilen. Bisher wurde vermutet, dass Faktoren wie körperliche Stärke oder bestimmte feste Verhaltensweisen bei der Hierarchieerkennung eine Rolle spielen. Die neuen Forschungsergebnisse stellen diese Annahmen jedoch infrage. Mäuse nutzen stattdessen chemische Signale, die in der Luft übertragen oder durch direkten Kontakt weitergegeben werden, um den sozialen Rang fremder Artgenossen einzuschätzen.
Das Team um Neven Borak und Jonny Kohl entwickelte ein Experiment, bei dem zwei männliche Mäuse in einem transparenten Schlauch aus entgegengesetzten Enden aufeinandertreffen. In dieser Begegnung zeigt sich oft das Rangverhältnis: Die unterlegene Maus zieht sich in der Regel zurück. Zuvor wurden die Tiere aufgrund ihres Verhaltens in gemeinsamen Käfigen in eine Rangordnung eingeordnet. In der darauffolgenden Phase beobachteten die Forscher, wie die Mäuse auf fremde Gegner reagierten. Dabei zeigte sich, dass die Tiere die Rangposition ihrer Gegenüber anhand von chemischen Signalen erkannten und diese Information mit ihrem eigenen sozialen Rang abglichen.
Je nach Ergebnis entschieden sie, ob sie sich zurückziehen oder das Territorium verteidigen. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt der Studie ist, dass die Erkennung der sozialen Rangposition auch im Dunkeln weiterhin funktioniert. Dadurch konnte ausgeschlossen werden, dass visuelle Hinweise wie Größe oder sichtbares Verhalten ausschlaggebend für das Rangverständnis sind. Ebenso zeigte die Entfernung von Sexualhormonen durch Kastration keinen Einfluss auf die Fähigkeit der Mäuse, soziale Hierarchien zu erkennen. Dies stärkt die Annahme, dass chemische Gerüche die zentralen Informationsquellen für solche Entscheidungen sind.
Mäuse verfügen über zwei zentrale chemosensorische Systeme, um Gerüche wahrzunehmen: das olfaktorische System, das flüchtige Geruchsstoffe in der Luft detektiert, und das vomeronasale System, das eher an die Wahrnehmung von direkten, nicht flüchtigen chemischen Signalen durch Körperkontakt angepasst ist. Im Versuch blockierten die Wissenschaftler diese beiden Systeme nacheinander und gleichzeitig, um herauszufinden, welchen Beitrag sie zur Erkennung der sozialen Rangordnung leisten. Die Ergebnisse zeigten, dass nur die gleichzeitige Blockade beider Systeme dazu führt, dass die Tiere den Rang ihrer Kontrahenten nicht mehr korrekt einschätzen können. Das bedeutet, dass Mäuse in der Lage sind, den Ausfall eines Systems zu kompensieren, indem sie das andere nutzen. Diese Fähigkeit zur Integration verschiedener sensorischer Informationen untermauert die Komplexität sozialer Verhaltensweisen auch bei kleinen Säugetieren.
Das Gehirn der Mäuse verarbeitet nicht nur die empfangenen Geruchssignale, sondern vergleicht diese auch mit der eigenen Hierarchiestellung. Bevor ein Tier in der Konfrontation entweder flüchtet oder sich durchsetzt, findet eine interne Bewertung der relativen Rangposition statt. Das widerlegt die Vorstellung, dass dominant oder submissiv agierende Mäuse von Grund auf feste Charakterzüge besitzen. Vielmehr ist ihr Verhalten eine dynamische Reaktion, die auf den aktuellen sozialen Kontext abgestimmt wird. Die Bedeutung dieser Forschung geht über das Verständnis von Mäusegesellschaften hinaus.
Auch Menschen erkennen soziale Statusunterschiede und passen ihr Verhalten an. Zwar erfolgt die Wahrnehmung hier besonders über visuelle und sprachliche Signale wie Kleidung, Mimik oder Stimme, doch das Prinzip, die eigene Stellung in relation zu anderen einzuschätzen, bleibt gleich. Die Studie am Francis Crick Institute macht deutlich, dass soziale Rangordnungen und deren Erkennung evolutionär tief verwurzelt sind und sich auf verschiedene sensorische Systeme stützen können. Die weitere Forschung fokussiert nun auf die Frage, in welchen Gehirnregionen die Informationen über den eigenen und den fremden Rang verarbeitet werden. Dabei sollen auch die neuronalen Mechanismen entschlüsselt werden, die letztlich zum Verhalten – sei es Rückzug oder Aggression – führen.
Erkenntnisse darüber könnten nicht nur das Verständnis von sozialem Verhalten bei Tieren erweitern, sondern auch potenziell neuartige Ansätze für die Behandlung sozialer Störungen beim Menschen liefern. Das State-Dependent Neural Processing Laboratory, wo dieses Forschungsprojekt durchgeführt wurde, beschäftigt sich mit der Frage, wie physiologische Zustände, etwa Stress, Schwangerschaft oder Schlaf, neuronale Schaltkreise beeinflussen. Indem sie untersuchen, wie interne Körperzustände das Verhalten steuern, hoffen die Wissenschaftler, wesentlich zum integrativen Verständnis von Gehirnfunktion und sozialem Verhalten beizutragen. Das Thema soziale Hierarchie und deren Erkennung durch chemische Signale bei Mäusen zeigt, wie komplex und fein abgestimmt tierische Kommunikation abläuft. Die Fähigkeit, neue Menschen oder Artgenossen schnell einzuschätzen und dementsprechend zu reagieren, ist ein evolutionärer Vorteil, der Konflikte minimiert und den sozialen Zusammenhalt stärkt.
Die Forschung am Francis Crick Institute beweist, dass auch kleine Säugetiere ein ausgeklügeltes System besitzen, um soziale Informationen über Geruch wahrzunehmen und zu verarbeiten. Diese Erkenntnisse laden dazu ein, die eigene soziale Umgebung aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Wie bei Mäusen spielt auch bei Menschen die Fähigkeit, den sozialen Status anderer zu erkennen und darauf zu reagieren, eine entscheidende Rolle im täglichen Leben. Ob bewusst oder unbewusst, verwenden wir verschiedene Sinneswahrnehmungen, um unser Umfeld einzuschätzen, einen Platz innerhalb der Gemeinschaft zu finden und soziale Interaktionen zu steuern. Mit fortschreitender Forschung könnten wir zukünftig gezielter verstehen, wie Sinnesinformationen und innere Zustände unser soziales Verhalten formen.
Dabei lohnt es sich, das faszinierende Zusammenspiel zwischen Umwelt, Gehirn und Verhalten sowohl bei Tieren als auch beim Menschen weiter zu erkunden und daraus neue Erkenntnisse für die Wissenschaft und Gesellschaft zu gewinnen.
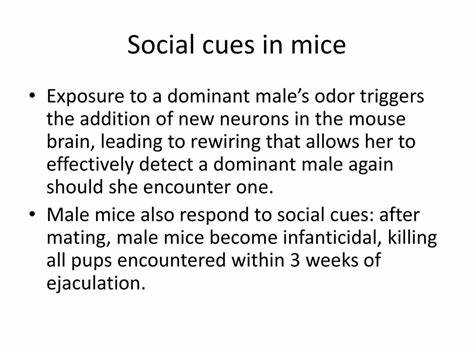


![Chromaplane Unlocked: The Electromagnetic Synth You Must Try [video]](/images/60088BD2-2CFF-446D-B4F2-FE8B8263DD13)