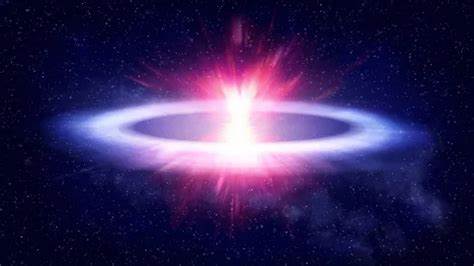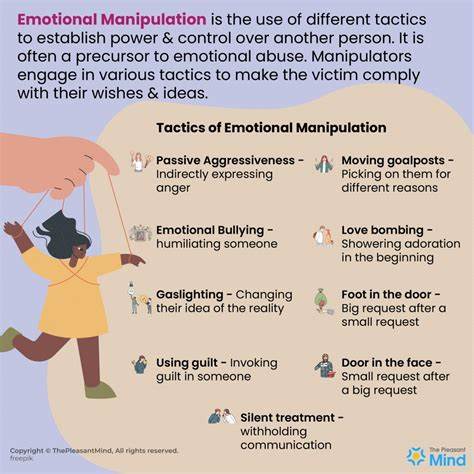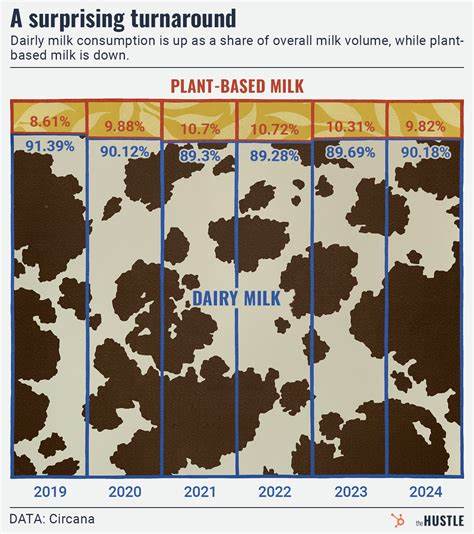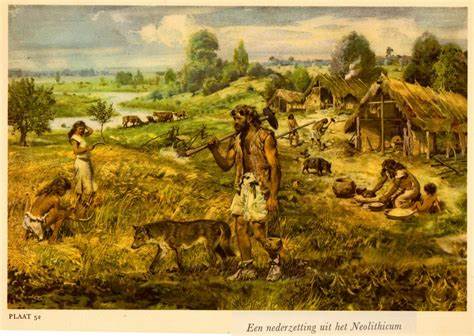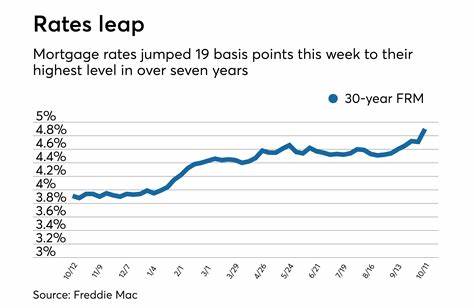Im Jahr 2018 erschütterte ein ungewöhnliches Ereignis die Welt der Astronomie: Eine extrem helle Explosion im tiefen Weltraum wurde entdeckt, die mit keiner bekannten Sternexplosion, auch Supernova genannt, vergleichbar war. Diese Explosion erhielt den Namen AT2018cow, doch in den folgenden Jahren entwickelten Astronomen und Fans aus der Fachwelt schnell einen einprägsameren Spitznamen – „die Kuh“. Was machte dieses Phänomen so besonders? Es war nicht nur extrem hell, bis zu hundert Mal heller als andere supernovaähnliche Ereignisse, sondern auch bemerkenswert schnell: Während klassische Supernovae Wochen oder sogar Monate benötigen, um sich vollständig zu entfalten und abzuschwächen, brauchte das Ereignis so kurze Zeit wie nur wenige Tage. Zudem war die Ausdehnung der Explosion vergleichbar mit der unseres gesamten Sonnensystems, was astronomisch betrachtet eine enorme Größe bedeutet. Seit damals wurden weitere ähnliche Ereignisse entdeckt, die ein neues Phänomen in der Astrophysik markieren: sogenannte luminous fast blue optical transients, kurz LFBots.
Diese Auffälligkeiten zeigen sich durch ihre außerordentliche Helligkeit, eine intensive blaue Färbung im Lichtspektrum und eine extrem schnelle Entwicklung von Leuchten zu Verblassen. Die blaue Farbe entsteht durch die hohe Temperatur der Explosionen - etwa 40.000 Grad Celsius, was die abgestrahlte Energie in den sichtbaren blauen Bereich verschiebt. Die Kombination dieser Eigenschaften unterscheidet sie deutlich von herkömmlichen kosmischen Ereignissen. Frühe Theorien versuchten, diese Explosionen als fehlgeschlagene Supernovae zu erklären.
Dabei würde ein Stern beim Versuch zu explodieren in sich zusammenfallen und ein Schwarzes Loch im Inneren bilden, das den Stern von innen heraus verschlingt. Dieses Modell konnte allerdings viele der beobachteten Details nicht zufriedenstellend abbilden. Insbesondere die ungewöhnliche Form und der schnelle Helligkeitsanstieg widersprechen den Erwartungen eines solchen Prozesses. Eine aktuell immer populärer werdende Hypothese arbeitet mit einer faszinierenden Idee: Der Ursprung dieser explosiven Strahlung könnten sogenannte intermediäre Schwarze Löcher sein, die noch schwer zu fassen sind und eine Nachbarschaft zwischen den bekannten kleinen Schwarzen Löchern – einige Male die Masse unserer Sonne – und den gigantischen supermassiven Schwarzen Löchern im Zentrum von Galaxien bilden. Diese intermediären Schwarzen Löcher hätten eine Masse zwischen ungefähr hundert- und hunderttausendfacher Sonnenmasse.
Nach dieser Annahme entstehen die LFBots, wenn ein Stern zu nah an ein solches mittelgroßes Schwarzes Loch gerät und von der starken Schwerkraft zerrissen und teilweise verschlungen wird. Dieser Prozess erzeugt eine leuchtende Scheibe aus Sternenmaterial, die sich vorübergehend sehr stark aufheizt und die beobachtbaren Explosionen verursacht. Die variierende Helligkeit lässt sich möglicherweise durch das unregelmäßige Verschlingen von Sternenfragmenten erklären, die das Schwarze Loch immer wieder für kurze Zeit heller strahlen lassen. Im Herbst 2024 veröffentlichte ein Forscherteam unter Leitung von Zheng Cao neue Untersuchungen dieser phenomenonartigen Explosionen mit tiefgreifenden Erkenntnissen. Die detaillierte Analyse von Röntgendaten und die Simulation einer akkretierenden Materiescheibe um das Schwarze Loch lieferten überzeugende Hinweise, dass das Ereignis tatsächlich auf den Prozess eines Sternverschlingens durch intermediäre Schwarze Löcher zurückzuführen ist.
Dieser Nachweis wäre ein bedeutender Meilenstein, da es bislang keine eindeutigen Beobachtungen dieser Zwischenklasse von Schwarzen Löchern gab. Das könnte das Verständnis über die Entwicklung von Schwarzen Löchern entscheidend erweitern und auch Hinweise auf dunkle Materie im Universum liefern, eines der größten kosmischen Rätsel unserer Zeit. Neben der Theorie der intermediären Schwarzen Löcher gibt es alternative Erklärungsansätze. Einige Wissenschaftler weisen darauf hin, dass es sich bei den Objekten, die bei den Explosionen zerfallen, auch um besonders massereiche Wolf-Rayet-Sterne handeln könnte. Diese Sterne sind für ihre unruhigen, heftigen Massenverluste bekannt und könnten durch kleinere Schwarze Löcher, die lediglich zehn- bis hundertfach die Sonnenmasse besitzen, zerstört werden.
Diese Szenarien sind noch weniger erforscht und erfordern umfangreiche astrophysikalische Modellierungen, doch zeigen sie die Vielfalt der Interpretationen, mit denen das Phänomen noch erforscht wird. Astronomen setzen zur Erforschung dieser seltenen Ereignisse auf umfangreiche Himmelsdurchmusterungen und schnelle Reaktionen zur Beobachtung. Moderne Systeme wie das Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas), das den ursprünglichen AT2018cow entdeckte, scannen systematisch den Himmel nach ungewöhnlichen Lichterscheinungen. Sobald ein Verdachtsfall entdeckt wird, setzen astronomische Gemeinschaften auf einen schnellen Datenaustausch über Online-Dienste wie den Astronomer's Telegram, damit Teleskope weltweit die Explosion im Detail erfassen können, bevor diese verblasst. Durch die Kombination verschiedener Teleskope und Beobachtungstechniken konnten Forscher bereits signifikante Daten sammeln, die von optischer Beobachtung bis hin zu Röntgenstrahlen reichen.
Besonders vielversprechend ist dabei die Nutzung von Weltraumteleskopen wie dem Hubble-Weltraumteleskop und künftig dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST). Diese Instrumente können hochaufgelöste Daten liefern und sind weniger durch atmosphärische Einflüsse eingeschränkt. Allerdings ist die Beobachtungszeit auf diesen Satelliten begehrt und schwer zu erhalten, was die Erforschung der LFBots bremst. Einige ForscherInnen haben schon mehrere Male Anträge gestellt, um die nächste Generation dieser Explosionen mit JWST beobachten zu dürfen. Die Seltenheit der LFBots erschwert die Forschung zusätzlich.
Bisher sind nur knapp ein Dutzend Fälle bekannt, was die statistische Grundlage für umfassende Ergebnisse schwächt. Mit den geplanten Starts neuer Weltraumteleskope wie dem israelischen Ultrasat, einem Ultraviolett-Transienten-Satelliten, erwarten Wissenschaftler eine deutlich größere Zahl an Entdeckungen. Ultrasat soll mit seinem extrem großen Sichtfeld bis zu 1000 Vollmonde gleichzeitig beobachten und somit deutlich häufiger solch seltene Ereignisse entdecken. Dadurch wird sich das Wissen über diese rätselhaften Explosionen in den kommenden Jahren erheblich vertiefen. Sollte sich die Theorie der intermediären Schwarzen Löcher als korrekt erweisen, ergibt sich daraus nicht nur die Möglichkeit, bisher nicht genau identifizierte Schwarze Löcher mittlerer Masse zu finden, sondern auch Einblicke in die Entstehung und Entwicklung supermassiver Schwarzer Löcher in Galaxienzentren zu gewinnen.
Ein komplett neues Kapitel der kosmischen Evolution könnte sich so aufschlagen, das eng mit der Frage nach der Zusammensetzung und Entwicklung des Universums verbunden ist. Bislang bleibt der Ursprung der rätselhaften Weltraumexplosionen jedoch ein faszinierendes Mysterium, das die Astronomie herausfordert und der Wissenschaft neue Forschungsfelder eröffnet. Diese kurzzeitig blitzenden, extrem energiereichen Phänomene zeigen, wie viel wir über die tiefsten Prozesse des Kosmos noch nicht verstehen und wie aufregend der Blick in den Weltraum sein kann, wenn er uns neue Geheimnisse offenbart. Der Ausblick für die Forschung in den nächsten Jahren ist vielversprechend. Mit verbesserten Teleskopen, schnelleren Datenübermittlungen und internationalen Kooperationen könnte das Rätsel um die LFBots bald gelüftet werden.
Dann werden wir wissen, ob die „Kuh“ und ihre tierischen Namensvettern wie der „Koala“, „Kamel“ oder „Tasmanische Teufel“ tatsächlich die Signale einer bislang unerkannten Klasse von Schwarzen Löchern sind – oder ob noch andere unbekannte kosmische Kräfte für ihr kurzzeitiges Leuchten verantwortlich sind. Bis dahin bleibt das Universum ein Ort voller Wunder und unerwarteter Überraschungen.