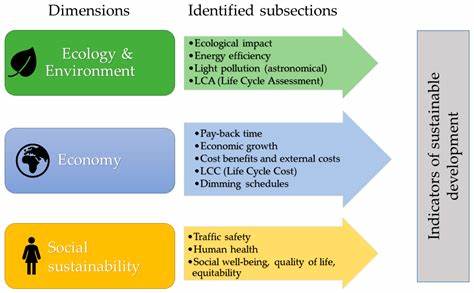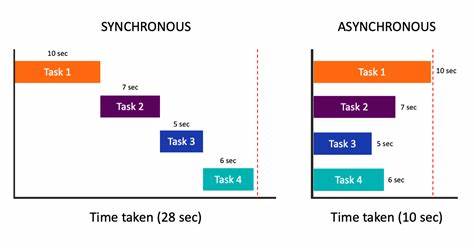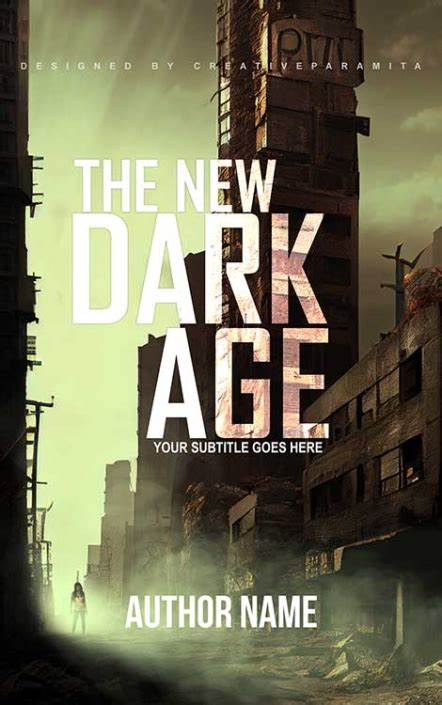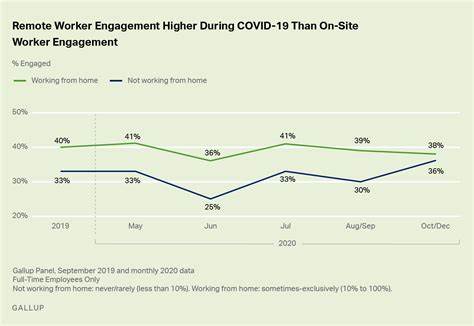Die Energiewende in Deutschland ist ein zentrales Element im Bestreben, den Klimawandel zu bekämpfen und den Ausstieg aus fossilen Energieträgern zu beschleunigen. Ein wesentlicher Baustein dafür ist die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Windkraft und Photovoltaik. Trotz sinkender Kosten dieser Technologien und technischem Fortschritt gibt es zunehmende Widerstände auf lokaler Ebene, die die Umsetzung großer Projekte erschweren. Eine der häufigsten Ursachen für diese lokale Ablehnung ist die visuelle Beeinträchtigung der Landschaft durch Großanlagen zur erneuerbaren Energiegewinnung. Dieses Spannungsfeld zwischen der erforderlichen Energiewende und dem Schutz der landschaftlichen Ästhetik führt zu komplexen Herausforderungen in der Planung und Umsetzung.
Die Sichtbarkeit von Windrädern und großflächigen Solaranlagen in landschaftlich wertvollen oder dicht besiedelten Regionen führt nicht selten zu Bürgerprotesten und verzögert Genehmigungsverfahren erheblich. Hier entsteht ein Zielkonflikt: Einerseits soll die Energiewende zügig realisiert werden, andererseits gilt es wichtige Landschaften und Naherholungsgebiete vor zu starker Beeinträchtigung zu schützen. Ein gerade erschienener wissenschaftlicher Beitrag untersucht erstmals quantitativ, wie sich Sichtbarkeitsbeschränkungen auf die systemweiten Kosten und die Gestaltung des Energiesystems in Deutschland bis zum Jahr 2045 auswirken. Methodisch verwendet die Studie eine sogenannte Reverse-Viewshed-Analyse. Dabei wird nicht von der geplanten Anlage aus die Sichtbarkeit berechnet, sondern umgekehrt von Orten mit hohem landschaftlichen Wert oder dichter Besiedlung ermittelt, welche Flächen zur Errichtung von erneuerbaren Anlagen aus deren Sicht sichtbar wären.
Diese Bereiche können dann in der Planung als Ausschlusszonen definiert werden, um Anlagen für die Anwohner und Besucher unsichtbar zu platzieren. Die Analyse berücksichtigte unterschiedliche Empfindlichkeitsszenarien, angefangen von der Minimierung der Sichtbarkeit aus den am höchsten bewerteten landschaftlichen Regionen bis hin zu einer sehr strengen Regelung, die Anlagen auch vor durchschnittlich bewerteten Gebieten versteckt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine moderate Berücksichtigung der Sichtbarkeitsaspekte, bei der Anlagen aus den schönsten und am dichtesten besiedelten Gebieten entfernt werden, nur geringe Auswirkungen auf das Potenzial und die Systemkosten hat. So gehen z.B.
nur rund zehn Prozent der Kapazitäten für Onshore-Windkraft verloren, wenn Anlagen aus Gebieten mit der höchsten landschaftlichen Bewertung ausgeschlossen werden. Die Zunahme der Kosten bleibt dabei vernachlässigbar. Diese moderate Einschränkung schützt gleichzeitig weniger als ein Prozent der Bevölkerung, führt aber zu verhältnismäßig kleinen Veränderungen im Energiesystem. Anders verhält es sich bei strengeren Szenarien, in denen erneuerbaren Energieanlagen aus Bereichen mit durchschnittlicher landschaftlicher Qualität oder denselben Sichtbarkeitsunschärfen aus dichter besiedelten Regionen entfernt werden. Hierbei reduziert sich das auf dem Festland verfügbare Potenzial für Onshore-Windanlagen um bis zu 99 Prozent, für Freiflächen-PV um bis zu 93 Prozent.
Diese starke Einschränkung wirkt sich gravierend auf das Energiesystem aus: Die jährlichen Kosten könnten gegenüber einem Szenario ohne Sichtbarkeitsbeschränkungen um bis zu 38 Prozent, bzw. 23,6 Milliarden Euro steigen. Zudem nimmt die Systemresilienz ab, da die Abhängigkeit von Offshore-Windkraft und Dach-PV-Anlagen massiv zunimmt und die Einspeisung von grünem Wasserstoff, vor allem aus Importen, stark wächst. Mit der starken Reduktion des Flächenpotenzials für große Windparks und Freiflächen-Photovoltaik verschiebt sich das Energiemix-Gleichgewicht in Richtung Offshore-Wind und dezentrale kleine PV-Anlagen auf Dächern. Das bedeutet, dass Deutschland seine bestehenden Offshore-Wind-Potenziale deutlich stärker ausschöpfen müsste – auch wenn Offshore-Anlagen oft höheren Investitionskosten und Genehmigungshürden unterliegen.
Zudem müssten große Mengen an Photovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäuden installiert werden. Die Studie zeigt, dass dafür fast 18-mal mehr Dachflächen-PV als derzeit vorhanden erforderlich sind; eine Herausforderung hinsichtlich der maximal verfügbaren Dachflächen, der gesellschaftlichen Akzeptanz und der technischen Umsetzbarkeit. Ein weiterer Effekt der eingeschränkten Flächennutzung ist die erhöhte Notwendigkeit von Importen für grünen Wasserstoff. Damit Deutschland trotz deutlicher Flächenbeschränkungen seine Klimaziele erreichen kann, müsste der grüne Wasserstoff größtenteils aus dem Ausland bezogen werden. Die Importe können jedoch kritisch gesehen werden, da durch die Verlagerung der Erzeugung potenziell Emissionen in andere Länder verlagert werden könnten, falls dort nicht dieselben nachhaltigen Standards eingehalten werden.
Dieses Szenario wirft somit neue Fragen hinsichtlich Versorgungssicherheit und gerechter Lastenverteilung in der Energiewende auf. Die Untersuchung verdeutlicht, dass eine komplette Unsichtbarkeit von großen Wind- und Solarparks aus landschaftlich sensiblen oder dicht besiedelten Gebieten derzeit mit erheblichen Mehrkosten und Systemeinschränkungen verbunden ist. Dennoch heben die Autoren hervor, dass eine moderate Berücksichtigung der Sichtbarkeitsinteressen durchaus machbar und kosteneffizient ist. Das bewusste Aussparen von Anlagen aus den landschaftlich hochwertigsten Gebieten kann daher ein strategisch sinnvoller Kompromiss sein, der sowohl den Ausbau der Erneuerbaren fördert als auch die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht. Die Studie liefert außerdem wichtige Hinweise für die politische Gestaltung und die räumliche Planung der Energiewende in Deutschland.
Es wird vorgeschlagen, differenzierte Ausschlusszonen entsprechend der landschaftlichen Bewertung und Bevölkerungsdichte anzuwenden. Dies erlaubt es regional variierende Anforderungen zu berücksichtigen und so den Ausbau sozial verträglicher zu gestalten. Maßnahmen wie gezielte Förderprogramme und vereinfachte Genehmigungsverfahren für Offshore-Wind oder Dach-PV in besonders sensiblen Regionen können den Ausgleich unterstützen. Ein weiterer Aspekt ist die Etablierung von Mitsprachemöglichkeiten und Beteiligung der lokal Betroffenen. Sichtbarkeit alleine bestimmt die Akzeptanz nicht.
Lokale Beteiligung in der Planung sowie innovative Konzepte für Eigentum und Nutzenverteilung vor Ort tragen ebenfalls dazu bei, Akzeptanzbarrieren abzubauen. So kann die Sichtbarkeitsfrage in einen größeren sozialen und politischen Kontext eingebettet werden. Die methodischen Innovationen der vorgestellten Reverse-Viewshed-Analyse eröffnen zudem neue Möglichkeiten für die großräumige Landschaftsplanung und zukünftige Forschung. In anderen Ländern könnten ähnliche Ansätze genutzt werden, um landschaftliche Prioritäten in die Energiewende zu integrieren und so konfliktträchtige Standorte frühzeitig zu identifizieren. Abschließend zeigt die Arbeit, dass der Wunsch einer vollständigen Unsichtbarkeit von Windrädern und Solaranlagen für manche Landschaften mit erheblichen Kosten und Einschränkungen verbunden ist, die die Energiewende verlangsamen können.
Andererseits kann eine wohlüberlegte Balance zwischen Landschaftsschutz und Energiebereitstellung zu Systemlösungen führen, die technisch, ökonomisch und sozial sinnvoll sind. Damit wird eine Grundlage geschaffen, um die Energiewende sowohl im Einklang mit Umweltschutz als auch mit gesellschaftlichen Bedürfnissen weiter voranzutreiben.