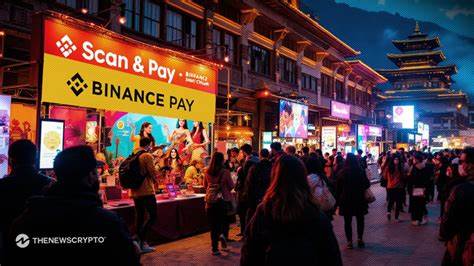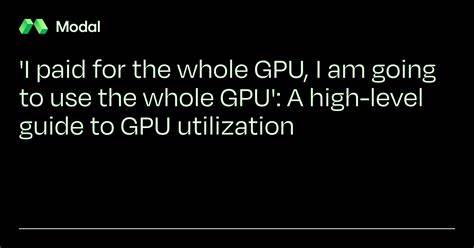Im Zeitalter der Digitalisierung schreitet die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in den Lebenswissenschaften in einem atemberaubenden Tempo voran. Von der präklinischen Arzneimittelentwicklung bis hin zur synthetischen Biologie und Diagnostik eröffnet KI neue Horizonte der Innovationsfähigkeit und Effizienz. Unternehmen, die als sogenannte AI-first-Firmen agieren, unterscheiden sich dabei erheblich von traditionellen, biologiezentrierten Akteuren. Anstatt auf biologischen Hypothesen oder klassischem geistigem Eigentum zu basieren, erscheinen sie häufig zunächst eher wie Forschungs- und Entwicklungsdienstleister mit großem Fokus auf datengetriebene Ansätze. Dieser Paradigmenwechsel birgt immense Chancen, aber auch eine Reihe fundamentaler Herausforderungen, denen sich die Akteure widmen müssen, um nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg in diesem Segment ist die Generierung großer, qualitativ hochwertiger und vor allem unvoreingenommener Datensätze. In der Arzneimittelforschung etwa existieren Daten häufig isoliert in den Datenbanken einzelner Unternehmen und werden selten offen geteilt. Im Gegensatz dazu profitieren Unternehmen im Bereich der Diagnostik oder Gesundheitssoftware von retrospektiven Studien, die durch gut vernetzte Kontakte innerhalb der medizinischen Gemeinschaft zugänglich sind. Gleiches gilt für die synthetische Biologie, die ähnliche Herausforderungen mit der Datenverfügbarkeit teilt. Die Akquisition solcher Daten ist jedoch mit erheblichen Investitionen verbunden.
AI-first-Unternehmen erschaffen eigene, maßgeschneiderte experimentelle Arbeitsabläufe, die stark auf Automatisierung und Robotik setzen, um beispielsweise wissenstragende Zelllinien, DNA-codierte Bibliotheken oder detaillierte Bildgebungsdaten in großer Menge und hoher Qualität zu erzeugen. Durch solche automatisierten Workflows gelingt die Optimierung der Datenausbeute und eine signifikante Verbesserung der Modellgenauigkeit, was wiederum neue Einblicke in Bereiche wie Wirkstoffentdeckung, Zelllinienentwicklung oder metabolisches Engineering erlaubt. Diese Firmen ähneln daher eher akademischen Laboren als klassischen Biotech-Unternehmen, was ihre Geschäftskonzepte vor allem für konservative Branchenakteure auf den ersten Blick ungewöhnlich macht. Neben den enormen Investitionskosten für den Aufbau der notwendigen Infrastruktur steht vor allem die Herausforderung im Mittelpunkt, ein interdisziplinäres Team aus hochqualifizierten Softwareingenieuren und Biologen zusammenzustellen und zu halten. Die enge Verzahnung von Computational Sciences und praktischer Laborarbeit ist dabei entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung datengestützter Projekte.
Gerade in der Arzneimittelentwicklung ist die Bereitschaft etablierter Player, hochdotiertes KI-Talent einzustellen und zu halten, oft begrenzt, was AI-first-Startups mit attraktiven Konditionen und innovativen Arbeitsumgebungen einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil verschafft. Firmen wie Insitro gelten hier als Vorreiter in der Anwerbung und Integration von Spitzentalenten aus beiden Welten. Sprachfertigkeiten und Verständnis für beide Disziplinen sind essenziell, denn nur so lässt sich eine tragfähige Grundlage schaffen, um anspruchsvolle, biologisch relevante Modelle zu entwickeln. Die Entwicklung solcher Modelle, die beispielsweise in der Lage sind, Zelltypen präzise zu klassifizieren, Arzneistoff-Wirkmechanismen zu prognostizieren oder genetische Schaltkreise zu analysieren, ist das Herzstück vieler AI-driven Life Sciences Unternehmen. Die Komplexität der biologischen Systeme, gekoppelt mit der enormen Datenvielfalt, stellt dabei eine große Hürde dar.
Ohne die Unterstützung erstklassiger Softwareentwicklung sind diese Herausforderungen kaum zu bewältigen. Durch kontinuierliches Training und Verbesserung der Algorithmen können Unternehmen so langfristig neue Wirkstoffkandidaten identifizieren oder metabolische Pfade optimieren. Interessanterweise beginnt die Reise vieler AI-basierter Lebenswissenschaftler nicht mit einer festen biologischen Hypothese, wie das in der traditionellen Biotechnologie üblich ist. Stattdessen investieren sie zunächst in aufwändige Daten- und Infrastrukturaufbauten, um eine umfassende, robuste Plattform zu schaffen. Dieser Ansatz steht im Gegensatz zum Virtual-Model-Ansatz, der vor allem in den letzten zwanzig Jahren durch die Nutzung von Auftragsforschungsinstituten geprägt war.
Während traditionelle Startups oft auf einfache, standardisierte Tests und frühe Hypothesen setzen, sind AI-first-Unternehmen auf maßgeschneiderte Experimente angewiesen, die sich nur schlecht outsourcen lassen. Allerdings entwickeln sich auch hier neue SaaS-Lösungen im Bereich Bioinformatik sowie erschwingliche Labormaterialien und Automationslösungen, die mittelfristig neue Möglichkeiten eröffnen werden. Angesichts der immensen Investitionskosten, die je nach Geschäftsmodell in die Millionen oder sogar bis in den hohen zweistelligen Millionenbereich gehen können, ist eine kluge Strategie zur Kapitalbeschaffung und Kostenkontrolle unabdingbar. Im Vergleich zu früheren Biotechnologie-Generationen mit deutlich niedrigeren Anfangsinvestitionen stellen KI-getriebene Unternehmen zudem höhere Anforderungen an die Skalierbarkeit und Qualität der erhobenen Daten. Eine weitere Besonderheit liegt in den laufenden Kosten, die durch die Modelle, die erforderlichen Rechenkapazitäten und die permanente Aktualisierung der Algorithmen entstehen.
Die Betriebskosten können durch den Einsatz moderner Cloud-Technologien und spezialisierter Hardware wie Tensor Processing Units zwar teilweise optimiert, aber nicht vollständig eliminiert werden. Die Herausforderungen im Bereich Talente sind ebenfalls ein zentrales Thema. Die lukrativsten KI-Experten sind nicht leicht zu gewinnen und angesichts des starken Wettbewerbs durch Tech-Giganten, Finanzunternehmen und andere Branchen müssen alle Bemühungen darauf ausgerichtet sein, exzellente Fachkräfte frühzeitig an Bord zu holen, zu entwickeln und langfristig zu binden. Erfolgreiche Strategien reichen von der Zusammensetzung eines erfahrenen Gründerteams mit hochklassigen KI-Experten über die Einbindung externer Berater bis hin zum Aufbau tatkräftiger Teams durch zielgerichtetes Training von Biologen im Bereich datenwissenschaftlicher Methoden. Die Entwicklung der Modelle selbst erfordert einen feinen Umgang mit Datenqualität und biologischer Validierung.
Unstrukturierte, verrauschte Daten stellen ebenso ein Problem dar wie die Frage des optimalen Zeitpunkts für die Produkteinführung von KI-gestützten Vorhersagemodellen. Genauigkeit allein reicht nicht aus; statistische Metriken wie ROC-Kurven oder AUC-Werte müssen stets im Kontext biologischer Relevanz interpretiert werden. Ebenso werden frühe positive Resultate oft durch unvorhergesehene Randfälle relativiert. Ein innovativer Ansatz ist dabei die Verwendung sogenannter „unphysikalischer“ biologischer Experimente, also Versuche, die primär zur Verbesserung der Modellgenauigkeit und nicht unbedingt zur direkten Gewinnung biologischer Erkenntnisse dienen. Die Komplexität biologischer Systeme sorgt dafür, dass auch zukünftige Entwicklungen in der KI diese Randphänomene aktiv mitberücksichtigen müssen, um praktikable Lösungen anbieten zu können.
Einige der erfolgreichsten AI-First Unternehmen im Lebenswissenschaften-Sektor haben erkannt, dass eine klare Spezialisierung auf bestimmte Problemfelder oder Datenmodalitäten entscheidend ist. So fokussieren sich Unternehmen auf die Forschung und Entwicklung von Antikörpern, viralen Transportvehikeln wie AAVs oder zellulären Therapien wie CAR-T-Zellen. Dieser enge Fokus ermöglicht eine Reduktion der Komplexität und eine effizientere Gestaltung der Kostenstruktur. Gleichzeitig sind die Unternehmen bemüht, sich nicht primär auf die Modelle oder Daten als Verteidigungsmauern im Wettbewerb zu verlassen, denn beide gelten zunehmend als commoditized. Stattdessen liegt der USP darin, die richtigen biologischen Fragestellungen zu adressieren und die passende Datenbasis kontinuierlich zu verbessern.
KI wird somit zum Werkzeug, das bei der Entwicklung neuartiger biologischer Produkte hilft und umgekehrt neue Märkte und Geschäftsmodelle erschließt. Die Transformation durch KI im Bereich der Lebenswissenschaften ist dabei nicht nur technologisch getrieben, sondern auch kulturell. Sie bewirkt ein Umdenken hinsichtlich der Fragestellungen, der Arbeitsweise im Labor und des Umgangs mit Daten. Unternehmen, die diese Entwicklung proaktiv gestalten, positionieren sich als Vorreiter in einem wettbewerbsintensiven Umfeld, welches von schnellem Wandel und großer Innovationskraft geprägt ist. Zukunftsperspektiven zeigen, dass KI nicht nur in den frühen Phasen der Wirkstoffentwicklung relevant sein wird.