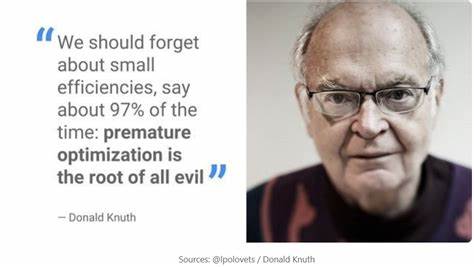Papst Leo XIV., geboren als Robert Prevost in Chicago, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der katholischen Kirche: Er ist der erste amerikanische Papst in der Geschichte. Diese Tatsache allein ist bemerkenswert, doch eine Frage zieht aktuell in den USA und international Aufmerksamkeit auf sich: Muss ein Papst, der sein Leben dem Armutsgelübde gewidmet hat, dennoch amerikanische Steuererklärungen abgeben? Und wenn ja, unter welchen Umständen könnte dies erforderlich sein? Als US-Staatsbürger ist Papst Leo XIV. grundsätzlich verpflichtet, seine weltweiten Einkünfte in den Vereinigten Staaten zu versteuern. Die US-Steuergesetzgebung steht an vorderster Stelle, wenn es um die Steuerpflicht von Bürgerinnen und Bürgern geht, egal an welchem Ort auf der Welt sie leben.
Selbst wenn keine Steuerlast entsteht, könnte eine Steuererklärung notwendig sein, etwa wenn bestimmte Einkommensgrenzen überschritten werden oder steuerliche Ansprüche geltend gemacht werden sollen. 2025 liegt die Einreichungspflicht beispielsweise bei einem Jahreseinkommen von 17.000 US-Dollar für Einzelpersonen über 65 Jahre. Im Fall von Papst Leo XIV. kommen allerdings spezielle Umstände zum Tragen, die diese Situation grundlegend beeinflussen.
Seine Verbindung zur Ordensgemeinschaft der Augustiner im Mittleren Westen der USA ist dabei von besonderer Bedeutung. Dieser Orden verlangt von seinen Mitgliedern ein sogenanntes „Solemnes Gelübde“ der Armut, das einen der strengsten Armutsgelübde in der katholischen Kirche darstellt. Mit dem Eintritt in den Orden, der bei Papst Leo im Jahr 1981 stattfand, unterschrieb er ein Dokument, das ihm jede Form von Besitz und Eigentum untersagt. Alle materiellen Güter müssen dem Orden übergeben werden, Eigentumsrechte werden aufgehoben. Die finanzielle Abwicklung innerhalb des Ordens ist klar geregelt.
So ist es üblich, dass Entgelt für geleistete Arbeit – zum Beispiel Gehälter für akademische Tätigkeiten – nicht an die einzelnen Mitglieder ausgezahlt, sondern direkt an die steuerbefreite Organisation überwiesen werden. Dadurch entsteht für die Mitglieder kein zu versteuerndes Einkommen. Geschenke oder andere Einkünfte werden ebenfalls an den Orden abgetreten, eine Praxis, die für Papst Leo keine Ausnahme bildete. Laut Aussagen des Augustiner-Schatzmeisters Fr. James Halstead übergab er auch Geldgeschenke, die er beispielsweise als Kardinal erhielt, vollständig an den Orden.
Darüber hinaus zählt zum System der Augustiner, dass die üblichen Sozialabgaben, wie Beiträge zur Medicare oder zur Sozialversicherung, nicht von den individuellen Mitgliedern abgeführt werden. Stattdessen übernimmt der Orden diese finanziellen Verpflichtungen für seine Mitglieder. Aus diesen Gründen haben die meisten Augustiner, inklusive Papst Leo XIV., üblicherweise keine individuelle Steuererklärung beim Internal Revenue Service (IRS) eingereicht. Der IRS erkennt die besonderen Umstände religiöser Orden an und bietet im Rahmen von Publikation 517 des IRS Leitlinien für Geistliche und deren Steuerpflicht.
Allerdings ist das Thema nicht frei von Kontroversen. In der Vergangenheit gab es Fälle, in denen das IRS die Gültigkeit von Armutsgelübden infrage stellte und diese steuerlich als nicht ausreichend für eine Befreiung akzeptierte. Somit bleibt auch für Papst Leo eine gewisse Unsicherheit, da nicht jedes religiöse Gelübde automatisch die Steuerpflicht aufhebt. Die genaue Ausgestaltung des Gelübdes sowie die tatsächliche Umsetzung der Verpflichtungen sind maßgeblich für die steuerliche Bewertung. Neben der Rechtslage stellt sich auch die philosophische und ethische Frage: Warum sollte ein Papst, der sich freiwillig zum Leben in Armut verpflichtet hat, überhaupt eine steuerliche Verpflichtung gegenüber einem weltlichen Staat haben? Diese Frage berührt das Spannungsfeld zwischen weltlichen Gesetzen und spirituellen Gelübden.
Die katholische Kirche als Institution besitzt umfangreichen Besitz und finanzielle Ressourcen, die jedoch unabhängig vom persönlichen Besitz des Papstes behandelt werden. Der Papst selbst verfügt nach seinem Gelübde juristisch betrachtet über keinerlei Eigentum. Zusätzlich zu den steuerlichen Erwägungen ist es bemerkenswert, dass das Armutsgelübde Papst Leo XIV. nicht nur von materiellen Gütern handelt, sondern auch einen gewissen Lebensstil und eine Distanz zu weltlichem Besitz und Einkommen einschließt. Dies macht die Situation einzigartig und zeigt die Herausforderungen auf, die entstehen, wenn ein Einzelner sowohl geistliche als auch staatsbürgerliche Verpflichtungen zu erfüllen hat.
Die Beziehung zwischen religiösen Gelübden und der Steuerpflicht ist ein faszinierendes Feld, das häufig in der Öffentlichkeit wenig Beachtung findet. Die Situation von Papst Leo XIV. wirft Licht auf die komplizierten Schnittstellen von Glauben, Recht und Praxis. Sie zeigt auch, wie fein die Balance sein muss, wenn globale Persönlichkeiten mit doppelten Identitäten als Staatsbürger und als spirituelle Leiter agieren. Schließlich ist festzuhalten, dass Papst Leo XIV.
aufgrund seines Armutsgelübdes und der besonderen Regelungen innerhalb des Augustinerordens wohl von einer regulären Steuererklärungspflicht in den USA befreit sein dürfte. Dennoch bleibt es eine außergewöhnliche rechtliche Situation, die im Detail genau betrachtet werden muss. Sie illustriert, wie einzigartige Lebenswege und Institutionen das ansonsten klare System der Steuerpflicht herausfordern können. Die Frage nach der Steuererklärung des Papstes ist somit nicht nur eine juristische, sondern auch eine symbolische. Sie erinnert daran, dass das Leben in Armut sowie die spirituelle Führung der katholischen Kirche in einem komplexen Bezug zum weltlichen Staat und dessen Regeln stehen.
Während Papst Leo XIV. sein Leben dem Dienst, der Bescheidenheit und der Armut gewidmet hat, lebt er zugleich in einer Welt, die von bürokratischen und rechtlichen Systemen geprägt ist – Systeme, die auch vor dem Oberhaupt der katholischen Kirche nicht haltmachen.