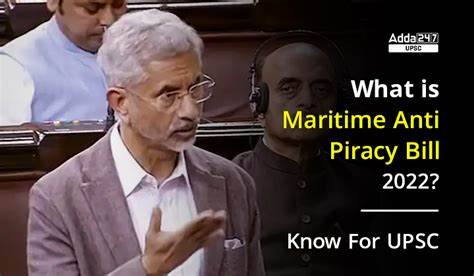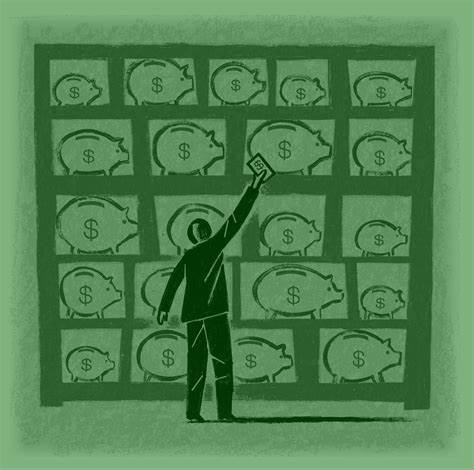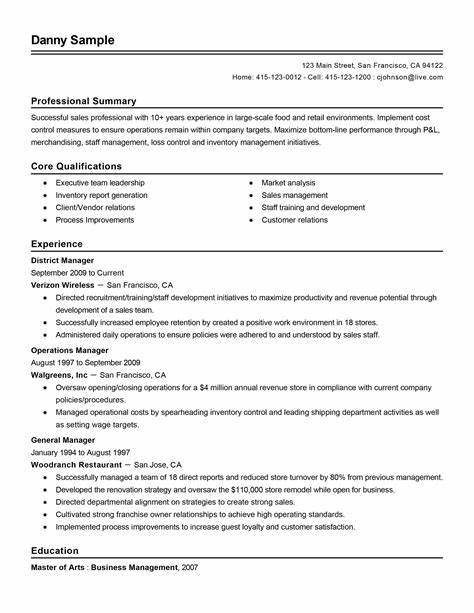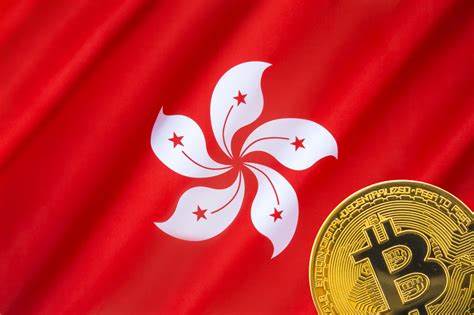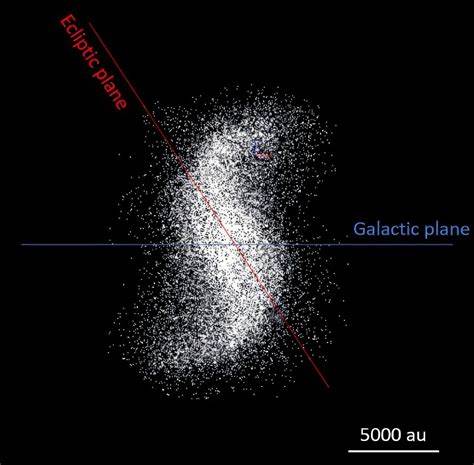Im Juni 2025 wurde ein neues US-amerikanisches Gesetzesprojekt vorgestellt, das die Bekämpfung der digitalen Piraterie auf ein neues Niveau heben möchte. Das American Copyright Protection Act (ACPA), initiiert vom republikanischen Abgeordneten Darrell Issa, schlägt einen alternativen Weg zur Sperrung von ausländischen Piratenseiten vor und stellt eine wichtige Entwicklung im amerikanischen Urheberrecht dar. Der Entwurf sieht vor, Rechteinhabern die Möglichkeit zu geben, gerichtliche Sperrungen gegen Webseiten durchzusetzen, die urheberrechtlich geschütztes Material illegal verbreiten, insbesondere dann, wenn die Betreiber der Seiten nicht in den USA ansässig sind bzw. nach angemessenen Ermittlungen nicht lokal ausfindig gemacht werden können. In den vergangenen Jahren lag der Schwerpunkt der Pirateriebekämpfung oft auf internationalen Maßnahmen, doch mit dem ACPA rückt die Problematik der Webseiten-Sperrungen wieder stärker in den Fokus auf dem amerikanischen Binnenmarkt.
Ein Überblick über die wesentlichen Aspekte und Auswirkungen des neuen Gesetzesentwurfs verdeutlicht die komplexen Herausforderungen und Chancen, die sich daraus ergeben. Die wichtigsten Bestandteile des ACPA für das Sperrverfahren Bei dem ACPA handelt es sich bislang um einen Diskussionsentwurf, der noch nicht als offizieller Gesetzestext vorliegt. Er sieht ein vierstufiges Prozessmodell vor, das die gerichtliche Feststellung, Umsetzung sowie Anpassung von Blockierungsanordnungen regelt. Zunächst muss ein Gericht feststellen, ob eine Webseite tatsächlich als „ausländische Piratenseite“ einzustufen ist. Zu diesem Zweck müssen Rechteinhaber stichhaltige Beweise vorlegen, die fortdauernde Urheberrechtsverletzungen belegen.
Außerdem müssen Informationen zur ausländischen Eigentümerschaft oder der fehlenden Auffindbarkeit von US-Betreibern erbracht werden. Entscheidend ist ebenfalls, dass die Seite überwiegend eine illegale Nutzung befördert oder aktiv auf Urheberrechtsverletzungen abzielt. Im Anschluss darf das Gericht Sperrmaßnahmen anordnen, die Internetdienstleister und DNS-Resolver verpflichten, „alle zumutbaren Schritte“ zu unternehmen, um den Zugang für Nutzer in den USA zu blockieren. Anders als in früheren Gesetzesvorhaben wird jedoch keine spezifische Technologie für die Sperrung vorgeschrieben, sondern den Betreibern ein gewisser Spielraum gewährt. Die Gültigkeitsdauer solcher Anordnungen ist auf maximal zwölf Monate begrenzt und eine Frist von zehn Tagen für die Umsetzung wird gesetzt.
Eine Verkürzung dieser Frist ist in dringenden Fällen, etwa bei „Live-Events“ wie Sportübertragungen oder Film-Premieren, möglich. Die weiteren Phasen des Verfahrens sehen vor, wie Sperrungen überprüft, aufrechterhalten oder gegebenenfalls modifiziert werden können, um neuen Umständen Rechnung zu tragen. Dieses strukturierte Vorgehen soll sowohl Rechtsklarheit schaffen als auch Missbrauch verhindern. Vergleich mit anderen Gesetzesinitiativen: ACPA versus FADPA Die ACPA steht nicht isoliert da. Zuvor hatte die demokratische Abgeordnete Zoe Lofgren bereits mit dem Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA) einen ähnlichen Gesetzesentwurf eingebracht, der ebenfalls die Sperrung ausländischer Piratenseiten ermöglicht.
Beide Gesetzesvorhaben haben viele Gemeinsamkeiten, wie etwa die Fokussierung auf DNS-Resolver und Internetdienstanbieter als Blockierinstanzen. Dennoch gibt es bedeutende Unterschiede. Während FADPA eine Erweiterung des US-Urheberrechts unter §502A vorsieht und Sperrungen häufig über die reguläre Bundesgerichtsbarkeit abwickelt, schlägt ACPA vor, dass ein speziell ausgewähltes Gremium von Bezirksrichtern innerhalb der Judicial Conference der Vereinigten Staaten zuständig sein soll. Damit wird ein zentralisierter und auf den Kampf gegen Piraterie spezialisierter Rechtsweg etabliert. Hinzu kommt, dass der ACPA-Entwurf vorsieht, dass das Gesetz Bundesrechtens vorgeordnet wird und somit bundesstaatliche oder lokale Gesetze zu dem Thema außer Kraft setzt.
Zudem soll das Government Accountability Office regelmäßig Berichte über die Effektivität und Auswirkungen des Gesetzes an den Kongress liefern, was eine laufende Überwachung und Evaluierung ermöglicht und so den politischen Entscheidungsträgern aktuelle Informationen an die Hand gibt. Transparenz und Schutzmechanismen als Kernpunkte Besonders hervorzuheben sind im ACPA-Entwurf die umfangreichen Transparenzvorgaben und Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Überblockungen. Das US-amerikanische Copyright Office wird mit der Pflege einer öffentlich zugänglichen Datenbank beauftragt, die sämtliche aktiven Sperrverfügungen auflistet. Dadurch soll eine nachvollziehbare Dokumentation sichergestellt werden, die für Öffentlichkeit und betroffene Nutzer gleichermaßen zugänglich ist. Zusätzlich müssen Rechteinhaber nachweisen, dass sie den Betreiber der Zielseite sowie die Domain-Registry über die vermeintlichen Urheberrechtsverletzungen informiert haben.
Das dient der Fairness und gibt potenziellen Betreibern die Gelegenheit, darauf zu reagieren. Eine wichtige Einschränkung betrifft den Kreis der Dienstleister, die Sperrmaßnahmen auferlegt werden können. So sind Anbieter mit einer Nutzerbasis von unter 50.000 Kunden oder solche, die weniger als 1 % des amerikanischen ISP-Marktes abdecken, ausgenommen. Außerdem werden Betreiber von Orten mit temporärem Internetzugang wie Cafés, Universitäten oder Bibliotheken ausdrücklich nicht in die Sperrpflicht einbezogen.
Diese Vorgaben sollen kleinere Anbieter und Bildungseinrichtungen von bürokratischem Aufwand entlasten. Ein weiterer bemerkenswerter Schutzmechanismus betrifft das Thema Überblockierung, also die versehentliche Sperrung legitimer Webseiten. Sollte eine harmlose dritte Partei von einer Fehlblockade betroffen sein, kann diese eine Entschädigung von bis zu 250.000 US-Dollar vom jeweiligen Rechteinhaber fordern. Dieses finanzielle Risiko zielt darauf ab, Rechteinhaber zur angemessenen Sorgfalt zu verpflichten und Schäden möglichst zu verhindern.
Die umstrittene Rolle der DNS-Resolver und die Kritik von Technikunternehmen Ein zentraler Streitpunkt im ACPA-Entwurf ist die Einbeziehung von DNS-Resolvern als Akteure im Sperrprozess. Das Domain Name System ist ein essenzieller Teil der Internetinfrastruktur, das URLs in IP-Adressen übersetzt und somit den Zugang zu Webseiten ermöglicht. Das Blockieren auf der DNS-Ebene kann technisch wirksam sein, birgt jedoch die Gefahr von weitreichenden Störungen und einer möglichen Zensurinfrastruktur. Die Internet Infrastructure Coalition (i2Coalition), die große Technologieunternehmen wie Amazon, Cloudflare und Google vertritt, hat bereits eine ausführliche Studie zu den Risiken von DNS-Blockaden veröffentlicht. Sie argumentiert, dass DNS-Resolver als neutrale Infrastrukturen nicht dafür verwendet werden sollten, politische oder inhaltliche Zensur durchzusetzen, da dies zu Übergriffen, Funktionsstörungen und langfristigen Schädigungen des offenen Internets führen kann.
Über die Plattform dnsatrisk.org wird umfassend über Erfahrungen und Probleme mit DNS-Blockierungen weltweit informiert, unter anderem aus Ländern wie Italien, Spanien oder Frankreich. Diese Bedenken zeigen, dass trotz der guten Absichten in Bezug auf Urheberrechtsschutz technologische und infrastrukturelle Überlegungen nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Immunitätsregelungen und Auswirkungen auf bestehende Rechte Die Diskussion um die Schuldfrage bei Sperrmaßnahmen ist ebenfalls wichtig. Der Entwurf sieht vor, dass Dienstleister, die eine gerichtliche Blockierverfügung in gutem Glauben umsetzen, von Urheberrechtsansprüchen befreit werden für die gekennzeichneten Piratenseiten während der Geltungsdauer der Anordnung.
Diese Immunität schützt Anbieter vor finanziellen Risiken, die aus der Umsetzung von Sperrbefehlen entstehen können. Allerdings wird klargestellt, dass diese Schutzregelung keine Auswirkungen auf andere Urheberrechtsklagen hat, insbesondere nicht auf Verfahren gegen Internetanbieter, die sich mit der Haftung von Anschlussnutzern befassen. Zudem soll das Gesetz keine Änderungen am Digital Millennium Copyright Act (DMCA) vornehmen oder die bestehenden Schutzmechanismen und Haftungsregelungen im Rahmen des DMCA beeinflussen. Gerade die schon lange andauernde Diskussion über die Balance zwischen Urheberrechtsschutz und Internetfreiheit macht diese Differenzierung bedeutsam. Konsequenzen für die Zukunft des US-Internetrechts und Pirateriebekämpfung Das ACPA-Projekt zeigt, dass der Kampf gegen digitale Piraterie in den USA einen wichtigen Schritt weitergeht.
Im Vergleich zu früheren Initiativen präsentiert es einen vergleichsweise ausgewogenen Ansatz mit juristischer Struktur, Transparenz und klaren Schutzvorkehrungen. Allerdings offenbart die Debatte um DNS-Blockaden und die Einbindung von Internetgrundlagen, wie schwierig es ist, technischen Fortschritt, Netzneutralität und Rechtssicherheit zu vereinen. Sollte sich der Entwurf in seiner jetzigen oder modifizierten Form durchsetzen, könnten Rechteinhaber deutlicher gegenüber Piratenseiten auftreten, während Internetprovider und Infrastrukturunternehmen neuen Verpflichtungen unterliegen. Gleichzeitig dürfte die öffentliche Kontrolle über Sperrmaßnahmen gestärkt werden, um Missbrauch und überzogene Eingriffe zu verhindern. Kritiker warnen jedoch davor, dass der Weg über DNS-Blockaden langfristig problematisch sein könnte und fordern alternative technische Lösungen oder den Fokus auf andere Bekämpfungsstrategien.
Die kommenden Monate werden zeigen, wie die politischen Entscheidungsträger den vielfältigen Interessen Rechnung tragen und welche Rolle das ACPA in der nächsten Phase des digitalen Urheberrechtsschutzes spielen wird. Zusammenfassend markiert das American Copyright Protection Act einen bedeutenden Entwicklungsschritt im US-amerikanischen Kampf gegen Online-Piraterie. Mit innovativen gerichtlichen Verfahren, klaren Transparenzregeln und einer sorgfältigen Abwägung von Rechten und Pflichten könnte es neue Maßstäbe setzen und das Urheberrecht zeitgemäß für das Internetzeitalter stärken. Gleichzeitig steht die Gesetzgebung vor der komplexen Aufgabe, Technologie, Recht und Freiheit in Einklang zu bringen, um eine offene und faire digitale Zukunft sicherzustellen.