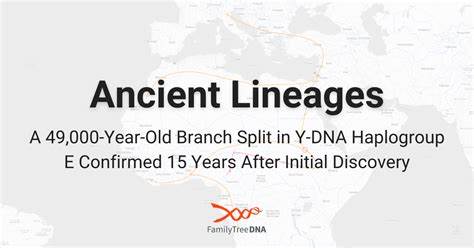Die Sahara ist heute als eine der trockensten und lebensfeindlichsten Wüstenregionen der Welt bekannt, doch vor rund 14.500 bis 5.000 Jahren präsentierte sie sich in einem vollkommen anderen Licht. Während des sogenannten African Humid Period (AHP), einer Phase verstärkter Niederschläge im mittleren Holozän, verwandelte sich die Sahara in eine grüne Savanne mit reichlich Wasserstellen, vielfältiger Vegetation und einer florierenden Tierwelt. Diese klimatischen Veränderungen ebneten den Weg für die frühe menschliche Besiedlung und die Entwicklung der Pastoralismus-Gemeinschaften in einer Region, die heute lebensfeindlich erscheint.
Doch bis vor Kurzem gab es kaum genetische Belege, um die Bevölkerungsgeschichte und ihre Dynamik in dieser sogenannten Grünen Sahara zu rekonstruieren, da die DNA-Erhaltung in heiß-trockenen Umgebungen äußerst schwierig ist. Eine bahnbrechende Studie, veröffentlicht im Jahr 2025 in der Fachzeitschrift Nature, hat erstmals die genomweite Analyse antiker menschlicher DNA aus der zentralen Sahara vorgestellt. Hierbei stammen die analysierten Proben von zwei etwa 7.000 Jahre alten weiblichen Individuen, die im Takarkori-Felsunterstand in den Tadrart Acacus-Bergen im Südwesten Libyens bestattet wurden. Die Ergebnisse enthüllen eine bisher unbekannte, tief verwurzelte nordafrikanische genetische Linie, die sich von den Linien subsaharischer Afrikaner bereits frühzeitig abzweigte.
Zudem blieb diese Population über viele tausend Jahre weitgehend isoliert, was bedeutende Auswirkungen auf das Verständnis der menschlichen Migration und der Ausbreitung kultureller Praktiken in der Region hat. Die genetische Analyse zeigt, dass die Takarkori-Vertreter eng verwandt sind mit den etwa 15.000 Jahre alten Iberomaurusianern aus dem Taforalt-Höhlenfundort in Marokko. Diese Verbindung verweist auf eine lange genetische Kontinuität und Stabilität der nordafrikanischen Bevölkerung vor und während der Afrikanischen Feuchtphase. Interessanterweise gibt es nur geringe Spuren eines genetischen Austauschs mit Subsahara-Afrika während dieser Periode, was den jahrtausendelangen Einfluss der Sahara als natürliche Barriere auf den Genfluss unterstreicht.
Die geringe Menge an Neandertaler-DNA in den Takarkori-Genomen, die deutlich unter den Werten liegt, die in Populationen des Nahen Ostens beobachtet werden, spricht ebenfalls für eine isolierte Bevölkerungsentwicklung in Nordafrika. Die Erkenntnisse aus Takarkori werfen ein neues Licht auf die Verbreitung der frühnachsteinzeitlichen Pastoralismus-Tradition in der Sahara. Archäologische Befunde deuteten bereits darauf hin, dass die Einführung von Viehzucht in die zentrale Sahara eher durch kulturelle Diffusion als durch große, migrationsbedingte Bevölkerungsverschiebungen erfolgte. Die genetischen Daten stützen diese These nun eindrucksvoll: Die Takarkori-Genetik zeigt nur minimale Levante-Einflüsse, was auf eine weitgehend einheimische Bevölkerungsbasis und eine schrittweise Übernahme von Viehzuchttechnologien durch lokale Gruppen im Rahmen komplexer kultureller Interaktionen hinweist. Die Takarkori-Funde bieten zudem wichtige Einblicke in die komplexen demographischen Muster Nordafrikas in der Vorgeschichte.
Die genetische Nähe zu den Iberomaurusianern und die damit verbundene tief verwurzelte Population unterstützen die Theorie, dass nach der Auswanderung des modernen Menschen aus Afrika eine eigenständige, lange isolierte nordafrikanische Bevölkerungsgruppe entstand. Diese Population wirkte als bedeutende genetische Quelle sowohl für spätere nordafrikanische Jäger und Sammler als auch für frühe neolithische Bauern in der Region. Interessanterweise führt die genetische Analyse auch zu einer Neubewertung früherer Modelle, die nordafrikanische Populationen, insbesondere die Iberomaurusier von Taforalt, als Mischungen von nahöstlichen Jägern-Sammlern (wie den Natufiern) und eher unspezifisch subsaharischen Gruppen beschrieben. Durch die Einbeziehung der Takarkori-DNA konnte nun gezeigt werden, dass der afrikanische Anteil eher aus einer eigenständigen und isolierten nordafrikanischen Linie stammt, die zuvor unbekannt war. Dies unterstreicht die Komplexität der menschlichen Evolution und Migration in diesem Teil Afrika und wirft ein neues Licht auf die genetische Landschaft, die sich bereits vor Tausenden von Jahren abzeichnete.
Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen hat die Studie auch Verbindungen zu heutigen Populationen hergestellt. Beispielsweise zeigen genetische Ähnlichkeiten zwischen Takarkori und den Fulani-Hirten in Westafrika eine mögliche Linie der Verbreitung früher Pastoralismus-Gruppen entlang der Sahel-Zone. Dies ist archäologisch durch Felskunst, Keramik und Bestattungspraktiken bestätigt, die biografische und kulturelle Entwicklungen im Verlauf des zunehmenden ariden Klimas am Ende des mittleren Holozäns widerspiegeln. Die Methodik der Studie war komplex und innovative Ansätze waren notwendig, um die extrem fragile DNA aus den Felsengräbern zu gewinnen und zu analysieren. Die Probenaufnahme, DNA-Extraktion und Genomsequenzierung wurden mit spezialisierten Verfahren durchgeführt, die die wiederholte Schädigung antiker DNA berücksichtigten und gleichzeitig Verunreinigungen minimierten.
In einem sogenannten DNA-Capture-Verfahren wurden gezielt über eine Million genetisch informative Positionen (SNPs) angereichert, um tiefgreifende Einblicke in seltene Genvarianten und Abstammungslinien zu ermöglichen. Analytisch wurden moderne und antike genomische Daten herangezogen, um die genetische Distanz der Takarkori-Individuen zu anderen Bevölkerungsgruppen Afrikas, des Nahen Ostens und Südeuropas einzuschätzen. Dabei kamen statistische Tools zur Messung von genetischem Drift und gemeinsamen Vorfahren zum Einsatz, ebenso wie Admixtur-Modelle und die Analyse von Neandertaler-DNA-Segmenten. Diese Kombinationsmethoden lieferten ein umfassendes Bild der Abstammungsbeziehungen, Isolationsmechanismen und potenziellen genetischen Mischungssignale. Die Erkenntnisse der Studie haben weitreichende Bedeutung für das Verständnis prähistorischer Menschheitsgeschichten in Afrika.
Sie demonstrieren erstens die Existenz einer bislang unbekannten, tief verwurzelten nordafrikanischen Population, die über Zehntausende von Jahren im Gebiet der heutigen Sahara lebte. Zweitens zeigen sie, dass sich sich kulturelle Innovationen wie die Viehzucht in der Sahara eher durch Wissensaustausch als durch massive Migrationen verbreiteten. Drittens verdeutlichen sie die lange genetische Trennung Nordafrikas vom subsaharischen Afrika trotz klimatischer Phasen erhöhter Feuchtigkeit, die das Potenzial für Bewegungen und Austausch erhöht hätten. Darüber hinaus öffnet die Arbeit neue Perspektiven für die Erforschung weiterer genetischer Hinterlassenschaften aus dieser Schlüsselregion Afrikas. Verbesserte DNA-Methoden und weitere Ausgrabungen könnten künftig das Bild noch verfeinern, insbesondere hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen lokalen Populationen und Einwanderungen aus angrenzenden Gebieten während und nach der Afrikanischen Feuchtphase.
Die Genetik der Grünen Sahara wirft auch Licht auf die globale Geschichte der menschlichen Besiedlung, Ausbreitung von Wirtschaftssystemen und komplexen sozialen Netzwerken vor tausenden von Jahren. Die Ergebnisse unterstreichen die Rolle der Sahara als natürliche Barriere, deren Einfluss auf Genfluss und Kulturentwicklung bis in die Gegenwart spürbar ist. Moderne genetische Studien zeigen weiterhin eine klare Differenzierung zwischen nördlichen und südlichen afrikanischen Populationen, was auf die historischen Grenzen zurückzuführen ist, die durch geographische, klimatische und soziale Faktoren entstanden. Insgesamt revolutionieren die Analysemethoden der antiken DNA aus der grünen Sahara unser Verständnis der menschlichen Geschichte in Nordafrika. Die Entdeckung einer eigenständigen, uralten nordafrikanischen Linie geht mit einem neuen Blick auf kulturelle Entwicklungen und Bevölkerungsbewegungen einher, die die Geschichte der Sahara und ihrer Menschen neu schreiben.
Somit liefert die Takarkori-Studie eine unverzichtbare Grundlage für zukünftige Forschungen zur menschlichen Evolution, Migration und Kultur in einem der faszinierendsten Regionen der Welt.