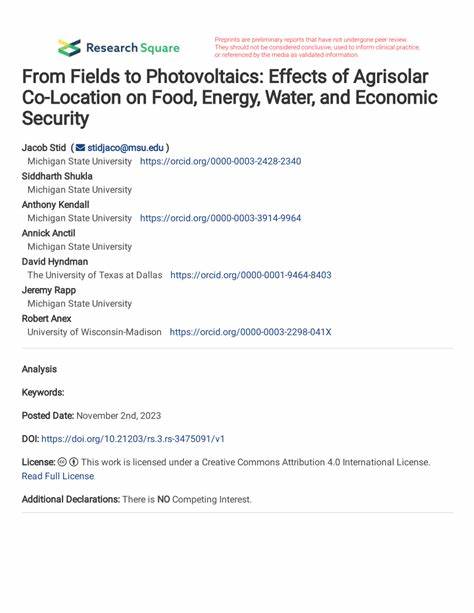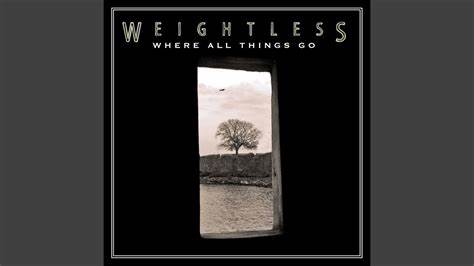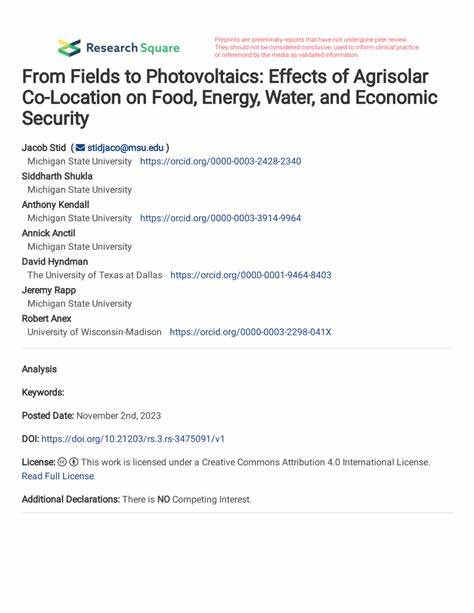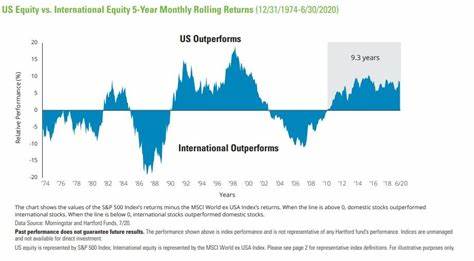Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts verlangen nach innovativen Lösungen, um den steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln, Energie und Wasser angesichts von Klimawandel und Ressourcenknappheit auszugleichen. Agrisolar, die Kombination von landwirtschaftlicher Nutzung und Photovoltaikanlagen, stellt eine aufkommende Praxis dar, die das Verhältnis zwischen Nahrung, Energie und Wasser grundlegend verändert. Besonders in landwirtschaftlich intensiv genutzten, aber zugleich wasserarmen Regionen eröffnen solche Co-Lokalisierungen Potenziale für nachhaltige Entwicklung, aber auch Herausforderungen, die eine differenzierte Betrachtung benötigen. Der Begriff Agrisolar beschreibt eine breite Palette von Praktiken, bei denen Solaranlagen entweder direkt auf den Feldern installiert werden – etwa über oder zwischen den Pflanzenreihen – oder landwirtschaftliche Flächen vollständig in Solarstromflächen umgewandelt werden.
Während die direkt integrierte Variante, auch Agrivoltaik genannt, häufig mit dem Ziel einhergeht, die Erträge landwirtschaftlicher Nutzpflanzen trotz oder gerade wegen der Verschattung durch die Solarmodule zu erhalten oder gar zu verbessern, bezeichnet die größere Fläche überdeckende Installation eine Umnutzung von Anbauflächen für Energiegewinnung. In der Praxis dominiert aktuell letzteres Szenario, das heißt die komplette Umwandlung von Ackerland in Solarstromanlagen, insbesondere bei großflächigen Projekten. Eine umfassende wissenschaftliche Studie, die sich mit den Auswirkungen von Agrisolar auf das empfindliche Zusammenspiel von Nahrungsmittelproduktion, Energie- und Wasserverbrauch beschäftigt, wurde im kalifornischen Central Valley durchgeführt. Diese Region steht stellvertretend für viele landwirtschaftlich wichtige, aber zugleich von Wasserknappheit betroffene Gebiete weltweit. Die Untersuchung erfasste fast tausend existierende Agrisolar-Installationen mit einer installierten Gesamtleistung von über 2,5 Gigawatt und einer Fläche von fast 4.
000 Hektar. Die Analyse erstreckte sich über verschiedene Maßstäbe, von kleinen gewerblichen Anlagen bis hin zu großen, nutzergroßen Solarparks. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen zugunsten von Solaranlagen zwar zu einem Verlust an direkter Nahrungsmittelproduktion führt – im Kalifornien-Fall entspricht der kalorische Verlust der Versorgung von etwa 86.000 Menschen über einen Zeitraum von 25 Jahren –, dass dieser Verlust jedoch mit signifikanten Vorteilen in anderen Bereichen aufgewogen wird. So konnte eine erhebliche Reduzierung des Wasserverbrauchs festgestellt werden, was in wasserarmen Gebieten unmittelbar zum Erhalt der landwirtschaftlichen Ressourcen beiträgt.
Die eingesparte Wassermenge wäre theoretisch ausreichend, um jahrzehntelang Millionen Menschen mit Trinkwasser zu versorgen oder tausende Hektar Obstplantagen zu bewässern. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Kombination aus Wasserersparnis und Solarenergieerzeugung zu einer gesteigerten wirtschaftlichen Stabilität für Landbesitzer führt. Insbesondere bei kleineren gewerblichen Agrisolar-Anlagen, die häufig den Net-Metering-Richtlinien unterliegen und somit den erzeugten Strom direkt im Betrieb nutzen oder überschüssigen Strom in das Netz einspeisen können, erreichen Landwirte deutlich höhere Einnahmen als durch reinen Ackerbau. Dies liegt nicht nur am Verkauf der erzeugten Energie, sondern auch an den eingesparten Betriebskosten, insbesondere jene für die Bewässerung. Bei großflächigen Solarparks, die oft verpachtete Flächen nutzen, sind die finanziellen Vorteile geringer, können aber dennoch attraktiv sein, besonders wenn Wasserknappheit den konventionellen Anbau zunehmend erschwert.
Wasserersparnis ist ein entscheidender Faktor bei der Bewertung von Agrisolar, vor allem da rund drei Viertel der untersuchten Solarflächen zuvor irrigierte Ackerflächen waren. Die Reduzierung des Wasserverbrauchs basiert nicht nur darauf, dass die mit Solarmodulen belegten Flächen nicht mehr bewässert werden müssen, sondern auch darauf, dass der Betrieb der Solaranlagen selbst vergleichsweise geringe Wassermengen erfordert, beispielsweise für Reinigung und Wartung. Die Studie fand zudem Hinweise darauf, dass Landbesitzer umliegendes Land oft bewusst brachlegen oder bewässern, insbesondere um Wasser zu sparen, während sie gleichzeitig Einnahmen aus der Solarausbeute erzielen. Diese Strategie, als solar unterstützte Brachenbewirtschaftung beschrieben, kann in der Summe den regionalen Wasserverbrauch signifikant senken und Landwirtschaft sowie Energieerzeugung besser miteinander verzahnen. Die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion sind komplex.
Zwar geht wertvolle landwirtschaftliche Nutzfläche verloren, besonders bei kalifornischen Spezialkulturen wie Nuss- und Obstplantagen, deren Anbau aufgrund von Klima- und Wasserbedingungen nicht leicht ausgelagert werden kann. Dennoch spielt der Gesamtmarkt eine Rolle: Ein Rückgang der Produktion an einem Ort kann durch Angebotserhöhungen an anderen Standorten, Anpassungen im Markt oder technologische Fortschritte teilweise kompensiert werden. Gleichzeitig ist Agrisolar deutlich energie-effizienter als bioenergetische Anbauformen, die zur Produktion von Biokraftstoffen dienen. Die Integration von Solaranlagen auf ehemaligen Kraftstoff-Pflanzenfeldern kann daher helfen, den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft zu optimieren. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben einen großen Einfluss auf die Akzeptanz und Umsetzung von Agrisolar.
Besonders attraktive Modelle erlauben Landwirten, ihren Eigenverbrauch durch Solarstrom zu decken und überschüssige Energie zu günstigen Konditionen in das Netz einzuspeisen. In Kalifornien haben beispielsweise Net-Metering-Programme hierfür vielfach den Anreiz geboten, trotz des Verlusts von Nahrungsmittelproduktion in Solarstrom zu investieren. Der wirtschaftliche Vorteil für Landbesitzer kann die entgangenen Erlöse aus der Landwirtschaft vielfach übersteigen – dies trifft vor allem auf kleinere kommerzielle Anlagen zu, die oft direkt von den Landwirten betrieben werden. Größere Solarfarmen basieren meist auf Verpachtungsmodellen, die geringere, aber stetige Einkünfte liefern. Zukunftsperspektiven für Agrisolar liegen vor allem in der Weiterentwicklung agrivoltaischer Systeme, bei denen Landwirtschaft und Solarenergie harmonisch koexistieren und sich gegenseitig unterstützen.
Dies kann durch innovative Anordnung der PV-Module, Pflanzenwahl, Bewässerungsstrategien oder das Einbeziehen naturnaher Ökosystemdienstleistungen erfolgen. Solche Systeme könnten helfen, Ernährungssicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig saubere Energie bereitzustellen, ohne wertvolle Agrarflächen dauerhaft zu verlieren. Darüber hinaus hat Agrisolar das Potential, Landwirte wirtschaftlich widerstandsfähiger gegen klimatische und wirtschaftliche Schocks zu machen. In Regionen mit zunehmenden Dürreperioden oder anderen negativen Effekten kann die teilweise Verwandlung von Feldern in Solarparkflächen eine Diversifizierung der Einkommen darstellen. Nicht zuletzt tragen solche Modelle zur Erreichung der Netto-Null-Ziele im Energiesektor bei, da Photovoltaik-Anlagen eine wichtige Rolle bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung spielen.
Trotz der erkennbaren Vorteile gibt es auch Herausforderungen und offene Fragen. Die Skalierbarkeit agrisolarer Konzepte hängt von technologischen, rechtlichen und landwirtschaftlichen Faktoren ab. Flächennutzungskonflikte, Bodenversiegelung, Auswirkungen auf Biodiversität sowie gesellschaftliche Akzeptanz müssen sorgfältig abgewogen werden. Ebenso sind Investitionen in Forschung und Entwicklung nötig, um optimale Kombinationen von Pflanzenarten und Photovoltaiksystemen zu identifizieren, die unter lokalen Bedingungen wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll sind. Abschließend lässt sich sagen, dass Agrisolar eine vielversprechende Strategie ist, um das komplexe Zusammenspiel von Nahrung, Energie und Wasser zukunftsfähig zu gestalten.
Die Praxis vereint die dringende Notwendigkeit, erneuerbare Energien auszubauen, mit dem Schutz und der nachhaltigen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Gerade in wasserarmen Regionen kann solche integrierte Nutzung dazu beitragen, die Wassernutzung zu reduzieren und dabei gleichzeitig Landwirte wirtschaftlich zu stärken. Damit könnte Agrisolar ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Agrar- und Energiepolitik sein, die ökologische, soziale und ökonomische Ziele miteinander vereint.