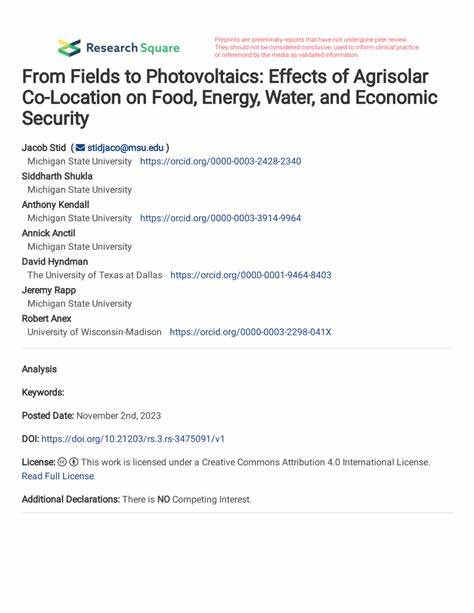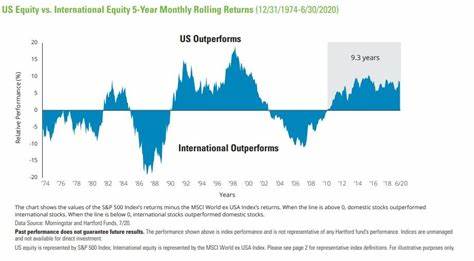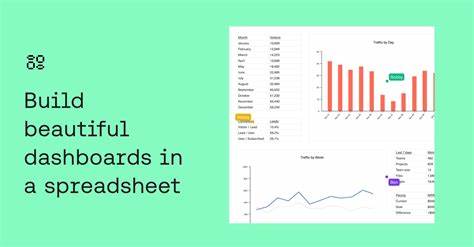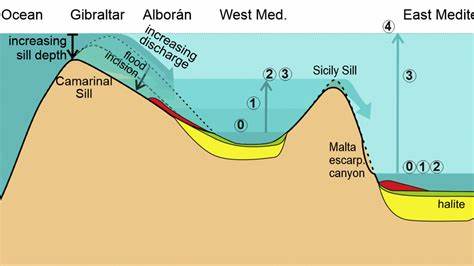Unter dem Begriff Agrisolar versteht man die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die gleichzeitige Erzeugung von Solarstrom und landwirtschaftlichen Produkten. Diese Dualnutzung von Flächen gewinnt aufgrund der global steigenden Anforderungen an Energie, Nahrung und Wasser zunehmend an Bedeutung. Agrisolar bietet die Möglichkeit, die wachsende Energienachfrage mit dem Schutz landwirtschaftlicher Ressourcen zu verbinden und so den komplexen Zusammenhängen zwischen Ernährungssicherheit, Energieversorgung und Wasserressourcen gerecht zu werden. In den letzten Jahren hat sich vor allem die US-amerikanische Region des California Central Valley (CCV) als ein wichtiges Studienareal für agrisolarisierte Flächen etabliert, was wertvolle Erkenntnisse über die Chancen und Herausforderungen dieser Verbindung liefert. Der weltweite Ausbau der Solar-Photovoltaik ist einer der Schlüssel zur Erreichung der Klimaziele und der Nettonull-Emissionen.
Gleichzeitig steht Ackerland unter immensem Druck, da sowohl die Nahrungsmittelproduktion als auch eine wachsende Bevölkerung und veränderte Klimabedingungen höhere Anforderungen stellen. Die starke Flächenintensität von Solarparks, insbesondere von bodengebundenen Anlagen, kollidiert oft mit der landwirtschaftlichen Nutzung – ein Zielkonflikt, der bislang kontrovers diskutiert wird. Agrisolar verfolgt dabei unterschiedliche Konzepte: Zum einen die indirekte oder angrenzende Nutzung, bei der landwirtschaftliche Flächen teilweise in Solarparks umgewandelt werden (agrisolar co-location). Zum anderen die direkte und integrierte Nutzung, bei der die PV-Module mit der Landbewirtschaftung kombiniert werden (agrivoltaic co-location). Diese Form der Integration kann beispielsweise darin bestehen, dass zwischen den Solarpanel-Reihen weiterhin Gras, Gemüse oder andere Nutzpflanzen gedeihen oder auch Weidehaltung unter den Panels erfolgt.
Die analysierten Daten des California Central Valley zeigen, dass bereits Tausende Hektar landwirtschaftlicher Flächen – über 3900 Hektar – für Solar-PV-Anlagen umgewandelt wurden. Diese Flächen entsprechen etwa 0,1 Prozent der aktiven Ackerflächen der Region. Es zeigt sich, dass die Umwandlung zur Solarenergie zwangsläufig zu einem Rückgang landwirtschaftlicher Produktion führt, vor allem bei Getreide, Obstanbau und Gemüseanbau. Die quantifizierte Verringerung der Nahrungsmittelproduktion entspricht einem Kalorienverlust, der über eine Zeitspanne von 25 Jahren etwa 86.000 Menschen ernähren könnte.
Diese Reduzierung der Nahrungsmittelmenge sorgt naturgemäß für Befürchtungen hinsichtlich der Ernährungssicherheit vor allem auf lokaler Ebene. Allerdings findet global gesehen ein Ausgleich statt, da Lebensmittelmärkte flexibel auf regionale Produktionsrückgänge durch Preissignale reagieren können. Dennoch sind Spezialkulturen mit hohem wirtschaftlichem und ernährungsphysiologischem Wert, wie Mandeln, Walnüsse oder Pfirsiche, besonders empfindlich und lassen sich nur schwer in andere Gebiete verlagern. Hierdurch entstehen Risiken für lokale Bauern und Märkte, die eine sorgfältige Planung der Flächennutzung notwendig machen. Eine bedeutsame positive Auswirkung von agrisolarer Flächennutzung zeigt sich in der Wasserressourcen-Bilanz.
Da mehr als 70 Prozent der Solaranlagen auf bewässerten Flächen errichtet wurden, führt die Umwandlung zum Wegfall des Wasserbedarfs für diese bewirtschafteten Flächen. Die Einsparungen können durchschnittlich 5.5 bis 6 Tausend Kubikmeter Wasser pro Hektar und Jahr betragen. Das entspricht in der Gesamtsumme Millionen Kubikmeter Trink- und Bewässerungswasser, die anderweitig eingespart oder flexibel genutzt werden können. In Wassermangelregionen wie dem CCV, die von wiederkehrenden Dürren betroffen sind, ist diese Wasserentlastung besonders wertvoll und kann als Beitrag zur nachhaltigen Wasserbewirtschaftung gewertet werden.
Darüber hinaus wirkt sich der Wegfall der Bewässerung auch auf den Energieverbrauch aus, da weniger Strom für Pumpen und Bewässerungssysteme benötigt wird. Insgesamt entstehen so wirtschaftliche Einsparungen und eine Entlastung der lokalen Netze. Die ökonomischen Effekte für Landbesitzer sind differenziert. Kleinere gewerbliche Photovoltaikanlagen bieten durch Net Energy Metering (NEM) innerhalb weniger Jahre eine attraktive Rendite. Trotz anfänglicher Investitionskosten überwiegen die Einspeisevergütungen und Einsparungen bei den Energiekosten deutlich die entgangenen Einnahmen aus der Landwirtschaft.
Die durchschnittliche Rendite kann hier leicht das 25-fache der entgangenen Erträge aus der landwirtschaftlichen Produktion betragen, bei einer amortisationszeit von gut fünf Jahren. Bei großflächigen Anlagen, die vorrangig durch Landpacht finanziert werden, ist die Ertragslage konservativer. Zwar fallen hier die Investitionskosten für den Landwirt weg, die Einnahmen durch Pachtzahlungen und die Einsparung der Betriebskosten können jedoch die entgangenen Erlöse durch Ernteverluste nur zum Teil kompensieren. In einigen Fällen kann dies sogar zu negativen finanziellen Effekten führen, was eine kritische Bewertung der Anreizsysteme und Fördermechanismen erforderlich macht. Auch wenn die wirtschaftlichen Vorteile in gewissen Fällen signifikant sind, gibt es Herausforderungen bei der langfristigen Sicherstellung der Ernährungssicherheit und Flächennutzungstransparenz.
Die Umstrukturierung von fruchtbarem Land zu Energieflächen könnte lokale Agrarmärkte verzerren und abhängig von politischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu sozialen Spannungen führen. Die Kombination von Solaranlagen mit landwirtschaftlicher Nutzung bietet hingegen ein großes Potenzial, die beschriebenen Nachteile zu minimieren. Die Agrivoltaik ermöglicht durch simultane Nutzung von Sonneneinstrahlung für die Energie- und Nebenertragsproduktion von Nahrungsmitteln eine Steigerung der Flächeneffizienz. Ein Teil der Kosten und Erträge kann zudem vom Landwirt direkt beeinflusst werden, was die Akzeptanz und Nachhaltigkeit stärkt. Darüber hinaus zeichnet sich Agrisolar nicht nur durch Vorteile im Bereich von Ernährungssicherung, Wasserwirtschaft und Energieversorgung aus, sondern auch durch ökologische Nebenaspekte.
So können Vegetation unter Photovoltaik-Anlagen zur Verbesserung der Bodenqualität, zur Erhaltung von Biodiversität und als Lebensraum für Insekten und andere Kleintiere beitragen. Dies unterstützt die Entstehung von resilienten Ökosystemdienstleistungen und erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung sowie bei Umweltschutzorganisationen. Zahlreiche politische Maßnahmen und gesetzliche Regelungen versuchen, durch gezielte Anreize die Installation von agrisolarer Infrastruktur zu fördern und gleichzeitig den Verlust von Ackerland zu vermeiden oder zu kompensieren. Im Bundesstaat Kalifornien etwa regelt das sogenannte Protecting Future Farmland Act die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen und den Ausbau erneuerbarer Energien. Hier werden Risiken adressiert und zugleich positive Synergieeffekte im Sinne der Techno-Ökologischen Synergien (TES) angestrebt.
Trotz der positiven Impulse bleiben viele Fragen zu optimaler Flächenauswahl, technologischer Gestaltung, ökologischen Wechselwirkungen und wirtschaftlicher Ausgestaltung offen. Hier besteht ein erheblicher Forschungsbedarf, um die vielfältigen Möglichkeiten der Agrisolar-Nutzung besser verstehen und effektiv steuern zu können. Etwa die Frage, wie sich verschiedene Kulturen, Bewässerungstechniken und lokale Klimabedingungen auf die gemeinsame Nutzung mit PV-Anlagen auswirken und wie sich die Auswirkungen auf Ernährungssicherheit und Wasserressourcen konkret messen lassen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die soziale Akzeptanz und die Verteilung der ökonomischen Vorteile. In vielen Regionen sind Landpachtverhältnisse komplex, und nicht immer erscheinen die erzielten Einnahmen an der richtigen Stelle.
Transparenz, Mitbestimmung und faire Bezahlung sind Voraussetzungen für einen gerechten Ausgleich zwischen Landwirten, Investoren und Gesellschaft. Darüber hinaus stellt die rasante Entwicklung der Solarenergie, etwa durch sinkende Herstellungskosten von PV-Modulen und neue Technologien wie Hochleistungs- oder gebäudeintegrierte Solaranlagen, die Agrisolar vor neue Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Die Kombination dieser Innovationen mit intelligentem Landmanagement und lokal angepassten Anreizsystemen könnte den Weg für eine zukunftsfähige multifunktionale Landnutzung ebnen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Agrisolar eine vielversprechende Strategie ist, um die zunehmenden Konkurrenzsituationen zwischen Lebensmittelproduktion, Energieerzeugung und Wasserverbrauch in wasserarmen und landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen zu adressieren. Die bestehenden Studien aus Kalifornien bieten wertvolle Praxisbeispiele und zeigen, dass trotz der Reduzierung der landwirtschaftlichen Produktion positive ökologische und ökonomische Akzente gesetzt werden können.