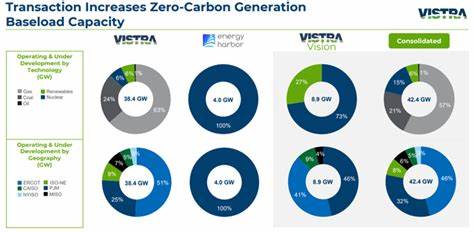Die europäische Halbleiterproduktion steht aktuell vor einem entscheidenden Wendepunkt. Trotz ambitionierter Versprechen und eines umfassenden Maßnahmenpakets steht die Branche vor großen Hürden, die eine rasche und substanzielle Steigerung der eigenen Chipherstellung erschweren. Die Ziele der EU, den Anteil der europäischen Halbleiterproduktion am globalen Markt bis 2030 auf etwa 20 Prozent zu steigern, wirken angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen zunehmend unrealistisch. Diese Einschätzung wurde eindrucksvoll vom Europäischen Rechnungshof formuliert, der die bisherigen Fortschritte und investiven Maßnahmen in einem Interimsgutachten evaluierte und vieles davon als „tiefgreifend realitätsfern“ bewertete. Die Ursachen für diese Kritik sind vielschichtig und verdienen eine differenzierte Betrachtung.
Die EU Chips Act-Initiative verfolgt das Ziel, durch Subventionen und Fördermaßnahmen die Produktion innerhalb Europas anzukurbeln. Dabei sollen sowohl internationale Großkonzerne wie auch heimische Hersteller motiviert werden, ihre Kapazitäten zu erweitern oder neue Werke zu errichten. Die Zahlen, die dabei zugrunde liegen, sind beeindruckend. Die geplanten Investitionen summieren sich auf Hunderte von Milliarden Euro bis zum Jahr 2030, wobei Staatshilfen und private Mittel in großem Umfang eingeplant sind. Prognosen großer Marktforschungsinstitute wie der International Data Corporation und der Semiconductor Industry Association zeigen jedoch, dass der Marktanteil Europas am globalen Halbleiterverkauf trotz dieser Investitionen deutlich unter dem gesetzten Ziel liegen wird.
Während Asia und die USA massiv ihre Kapazitäten ausbauen, droht Europa ins Hintertreffen zu geraten. Ein besonders schwerer Rückschlag ist die Verschiebung und möglicherweise dauerhafte Aussetzung des Mega-Projekts von Intel in Magdeburg. Das geplante Werk, das mit Investitionen von über 30 Milliarden Euro den bisher größten Beitrag zur europäischen Chipproduktion hätte leisten sollen, ist auf unbestimmte Zeit pausiert. Dieser Schritt hat nicht nur eine Lücke in der Produktion geschaffen, sondern auch das Vertrauen in die Stabilität des europäischen Produktionsausbaus erschüttert. Neben Intel gibt es weitere vielversprechende Projekte, beispielsweise in Dresden, die jedoch ebenfalls von zahlreichen Unsicherheiten und langen Planungs- und Bauzeiten geprägt sind.
Die komplexen Lieferketten, die nötige Präzisionstechnologie und die hohen Anforderungen an modernste Fertigungstechniken stellen erhebliche Barrieren dar. Ein weiteres Problemfeld zeigt sich bei der Verteilung und Kontrolle der Fördergelder. Die EU-Kommission ist zwar Initiator der Chips Act-Initiative, doch die konkrete Umsetzung und Überwachung der Investitionen liegt überwiegend bei den einzelnen Mitgliedstaaten. Dieses dezentrale Vorgehen erschwert eine konsistente Überwachung und Evaluierung, wodurch Fördermittel teilweise ineffizient oder unkoordiniert eingesetzt werden. Auch die angestrebte Öffnung der Förderregeln, um größere Hilfen für einzelne Unternehmen zu ermöglichen, birgt Risiken hinsichtlich Wettbewerbsverzerrung und nachhaltiger Investitionsförderung.
Inhaltlich haben die Unterstützungsprogramme zudem eine Gewichtung auf moderne, hochentwickelte Fertigungsverfahren gelegt. Interessanterweise zeigt eine Umfrage aus dem Jahr 2022, dass die Industrie in Europa derzeit vor allem eine Nachfrage nach älteren und weniger komplexen Fertigungstechnologien hat, die kostengünstiger sind. Dieses Missverhältnis könnte dazu führen, dass essentielle Marktsegmente nicht ausreichend bedient werden, was die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt beeinträchtigen würde. Trotz der Schattenseiten gibt es auch positive Entwicklungen. Die Förderung von Universitäten, Start-ups und kleinen bis mittleren Unternehmen im Bereich Chipdesign und Produktion ist im Aufbau begriffen.
Die Einrichtung einer neuen europäischen Entwicklungsplattform etwa soll internationale Konkurrenzfähigkeit stärken und Innovationskraft bündeln. Pilotanlagen für Chiptests und eine bessere Vernetzung der Forschungsinfrastruktur können langfristig die Grundlage für einen eigenständigen Innovationszyklus in Europa legen. Zudem sieht die Chips Act-Regelung die Möglichkeit vor, im Krisenfall benötigte Chips bevorzugt auf europäischen Boden herzustellen. Als Lehre aus der Corona-bedingten Chipkrise wurde ein Mechanismus entwickelt, der im Ernstfall das europaweite Chipangebot sichern soll. Erste Hersteller haben bereits entsprechende Zertifizierungen beantragt.
Dennoch bleibt die Herausforderungen umfassend. Der Europäische Rechnungshof empfiehlt deshalb eine kritische Neubewertung der Ziele und Maßnahmen. Eine systematische und transparente Überwachung der Mittelflüsse und Fortschritte wird ebenso gefordert wie eine realitätsnahe Nachjustierung des Förderprogramms. Die Entwicklung eines Nachfolgepakets, das nicht unter Zeitdruck und nach den Erfahrungen früherer Förderwellen entworfen wird, erscheint ebenso notwendig wie ein strategisches Gesamtkonzept, das die europäischen Stärken in Forschung, Produktion und Markt besser kombiniert. Die Chipindustrie ist ein globaler Wettbewerb mit enormer Dynamik, bei dem technologische Innovationen, Kapitalstärke und politische Willensbildung miteinander verzahnt sind.
Europa steht vor der Herausforderung, hier nicht nur aufzuholen, sondern eine eigenständige und nachhaltige Position zu behaupten. Die vielfältigen Investitionsprojekte, die Ausbaupläne und die politischen Ambitionen zeigen zwar den Willen zur Stärkung, doch die Diskrepanz zwischen diesen Ambitionen und der Wirklichkeit darf nicht länger unterschätzt werden. Nur mit einer offenen und kritischen Analyse kann Europa seine Rolle im globalen Halbleitermarkt festigen und die Chance nutzen, die technologische Souveränität zu erhöhen. Die nächsten Jahre werden entscheidend, um die Weichen richtig zu stellen – nicht nur für die Industrie, sondern für die Technologiezukunft des Kontinents insgesamt.