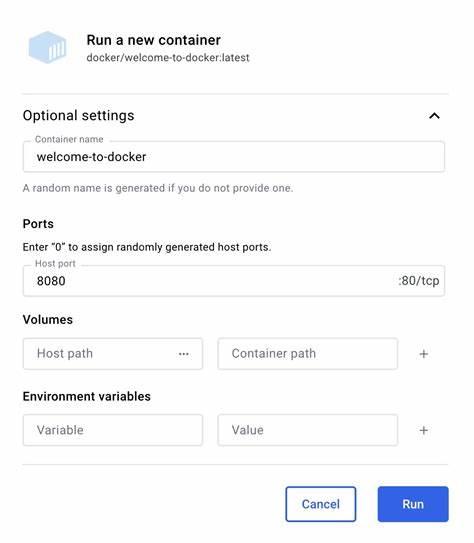Die digitale Bildgebung hat in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht, doch viele Herausforderungen bestehen weiterhin, insbesondere bei der Lichtausbeute, Farbwiedergabe und Auflösung. Forscher an der ETH Zürich und dem Empa haben in jüngster Zeit eine bahnbrechende Technologie vorgestellt, die das Potenzial besitzt, die Bildsensorik grundlegend zu verändern – Bildsensoren auf Basis von Perowskit. Diese neue Generation von Sensoren verspricht nicht nur bessere Bilder unter schwierigen Lichtbedingungen, sondern bietet auch Vorteile für den Einsatz in der maschinellen Bildverarbeitung. Die Entwicklung eröffnet neue Perspektiven in verschiedensten Anwendungsbereichen und zeichnet sich gleichzeitig durch die Möglichkeit kleinerer, effizienterer Sensoren aus. Perowskit: Ein vielseitiges Halbleitermaterial Im Zentrum der Innovation steht das Halbleitermaterial Perowskit, das bereits in den letzten Jahren für Fortschritte in der Solarzellenforschung bekannt geworden ist.
Perowskite besitzen einzigartige optische und elektronische Eigenschaften, die sich von denen des etablierten Siliziums deutlich unterscheiden. Während Silizium häufig im gesamten sichtbaren Spektrum Licht absorbiert und daher auf Farbfilter angewiesen ist, ermöglichen perowskitbasierte Sensoren eine selektive Absorption von Licht je nach chemischer Zusammensetzung des Halbleiters. Durch die gezielte Variation der Ionen in der Perowskitstruktur können Forscher einstellen, welche Lichtwellenlänge ein einzelner Pixel absorbiert: Mehr Iodid sorgt für absorbiertes rotes Licht, mehr Bromid für grünes und mehr Chlorid für blaues Licht. Diese Eigenschaft erlaubt es, die RGB-Pixel übereinander zu stapeln, anstatt sie nebeneinander anzuordnen – eine technische Neuerung, die deutlich effizientere Nutzung des verfügbaren Lichts ermöglicht. Effiziente Lichtausbeute dank vertikal gestapelter Pixel Das grundlegende Problem traditioneller Silizium-Bildsensoren ist der Lichtverlust.
Weil die Pixel nebeneinander liegen, können sie nicht jedes Photon aufnehmen, ohne jedoch bestimmte Filter einzusetzen, sodass ein Großteil des Lichts blockiert oder verschwendet wird. Perowskit-Sensoren hingegen nutzen jeden verfügbaren Lichtstrahl optimal, in dem die verschiedenen Farbschichten nacheinander liegen und somit ein Photon potenziell mehrfach genutzt wird, um unterschiedliche Wellenlängen zu erfassen. Diese Anordnung führt theoretisch zu einer dreifachen Lichtausbeute und dreimal höherer räumlicher Auflösung bei gleicher Sensorfläche im Vergleich zu Silizium-Bildsensoren. Erste Prototypen, entwickelt von den Wissenschaftlern um Prof. Maksym Kovalenko, belegen diese Effizienz und zeigen, dass die Technologie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch umsetzbar ist.
Verbesserte Farbtreue und reduzierte Bildartefakte Ein weiterer Vorteil der Perowskit-Sensoren liegt in der verbesserten Farbwiedergabe. Weil jeder Pixel genau auf eine bestimmte Wellenlänge zugeschnitten ist und keine zusätzlichen Farbfilter benötigt, treten weniger Fehler in der Farbabstimmung auf. Zudem entfallen Bildfehler, die bei traditionellen Sensoren durch sogenannte Demosaicing-Prozesse entstehen – Algorithmen, mit denen aus gefilterten Farbpixeln ein vollständiges Bild zusammengesetzt wird. Diese Prozesse berufsbedingt oft Moiré-Effekte oder Farbsäume, die mit der neuen Technologie stark reduziert werden. Diese Qualität spielt nicht nur in der Verbraucherfotografie eine Rolle, sondern ist auch für professionelle Anwendungen essenziell, bei denen die Farbgenauigkeit und Detailtreue von großer Bedeutung sind, beispielsweise in der medizinischen Bildgebung oder der Umweltüberwachung.
Maschinelles Sehen mit Perowskit-Sensoren Während das RGB-Farbsystem vor allem durch die menschliche Wahrnehmung vorgegeben ist, stellt das maschinelle Sehen ganz andere Anforderungen an die Sensorik. Wenn Maschinen Anwendungen wie Qualitätskontrolle, landwirtschaftliche Überwachung oder medizintechnische Diagnosen durchführen sollen, sind oft weitere Wellenlängenbereiche wichtig, die über das sichtbare Spektrum hinausgehen. Hier kommen hyperspektrale Bildsensoren zum Einsatz, die eine Vielzahl farblich klar getrennter Kanäle erfassen können. Die perowskitbasierte Technologie bietet sich deshalb im besonderen Maße an. Durch die flexible chemische Anpassbarkeit der Perowskitschichten können mehrere, exakt definierte Wellenlängenbereiche abgedeckt werden, was eine präzise und vielseitige hyperspektrale Bildgebung ermöglicht.
Im Vergleich zu Silicon-Sensoren, die auf aufwendige Filtertechniken und komplexe Algorithmen angewiesen sind, gestaltet sich die Umsetzung einfacher und effizienter. Anwendungen in Medizin, Umwelt und Landwirtschaft Die Vorzüge dieser neuen Sensoren finden in zahlreichen Bereichen Anwendung. In der Medizin kann eine präzisere Bildgebung etwa dazu beitragen, Krankheiten früher und genauer zu diagnostizieren. Hyperspektrale Sensoren könnten unterschiedliche Gewebetypen besser erkennen oder pathologische Veränderungen sichtbar machen, die mit herkömmlicher RGB-Bildgebung unerkannt blieben. Auch in der Umweltüberwachung werden hyperspektrale Daten genutzt, um etwa Pflanzenzustände, Verschmutzungen oder Veränderungen im Ökosystem zu identifizieren.
Perowskit-Sensoren könnten hier kleinste Veränderungen deutlich schneller und kostengünstiger registrieren. In der Landwirtschaft eröffnen sich daraus neue Möglichkeiten für automatisierte Bewässerungssteuerung, Schädlingsbekämpfung und Ertragsüberwachung. Technische Herausforderungen und Entwicklungsperspektiven Obwohl die bisherigen Ergebnisse vielversprechend sind, befinden sich perowskitbasierte Bildsensoren noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Die ersten Prototypen besitzen Pixelgrößen im Bereich von 0,5 bis 1 Millimeter – deutlich größer als kommerzielle Siliziumsensor-Pixel, die im Mikrometerbereich liegen. Die Forscher sind jedoch zuversichtlich, dass sich Perowskit-Pixel auch auf kleinere Abmessungen skalieren lassen, womit sie eine noch höhere Auflösung ermöglichen würden.
Ein weiterer Aspekt ist die Anpassung der Elektronik. Die bereits etablierte Auslesetechnik ist auf die Eigenschaften von Silizium ausgelegt. Perowskit, als anderes Halbleitermaterial, erfordert neue elektronische Strukturen und Verarbeitungsschritte. Die Forschungsgruppe um Kovalenko arbeitet intensiv daran, diese Hürden zu überwinden, denn die Materialeigenschaften sind teilweise fundamental unterschiedlich. Zusätzlich gilt es, die Langzeitstabilität und Umweltresistenz von Perowskit-Sensoren zu verbessern.
Perowskite sind empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff, was bisher die Produkttauglichkeit eingeschränkt hat. In den vergangenen Jahren jedoch wurden erhebliche Fortschritte bei der passiven und aktiven Schutzschichten entwickelt, die die Haltbarkeit deutlich verlängern. Nachhaltigkeit und industrielle Fertigung Ein entscheidender Vorteil der Perowskit-Technologie liegt in der potenziellen Kosteneffizienz und dem industriellen Fertigungsprozess. Perowskit-Schichten lassen sich mittels Dünnschichtverfahren auf unterschiedlichen Substraten auftragen, was eine skalierbare und ressourcenschonende Produktion ermöglicht. Im Vergleich zur komplexen Herstellung von Silizium-Bildsensoren kann diese Methode eine energie- und kostengünstigere Alternative darstellen.
Diese Aspekte sind für die zukünftige Verbreitung der Perowskit-Bildsensoren von großer Bedeutung. Gerade Hersteller von mobilen Endgeräten, medizinischen Geräten oder automatisierten Überwachungsanlagen sind auf zuverlässige, preiswerte und qualitativ hochwertige Sensorlösungen angewiesen. Zukunftsaussichten Die Entwicklungen an der ETH Zürich und dem Empa zeigen, dass perowskitbasierte Bildsensoren eine vielversprechende Technologie für die Zukunft der digitalen Bildgebung sind. Der Einsatz kann weit über die klassischen Anwendungsszenarien von Smartphones und Kameras hinausgehen. Anpassbare Pixelstrukturen ermöglichen speziell aufwendungsorientierte Sensoren, die sowohl die Anforderungen von Menschen als auch die von Maschinen erfüllen.
Bisherige Fortschritte markieren den Übergang von theoretischer Machbarkeit hin zu konkreten, miniaturisierten Prototypen. Die nächsten Meilensteine umfassen die Verkleinerung der Pixel, die Integration neuer Ausleseelektronik sowie Verbesserungen in der Langzeitstabilität. Werden diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert, dürfte die neue Perowskit-Technologie das Potenzial haben, die Welt der Bildgebung nachhaltig zu verändern. Fazit Perowskit-basierte Bildsensoren sind eine revolutionäre Neuerung im Bereich der digitalen Bildverarbeitung. Sie bieten eine wesentlich höhere Lichtausbeute, bessere Farbtreue und eine effektivere Nutzung des Sensors im Vergleich zu aktuellen Silizium-Bildsensoren.
Besonders durch die Möglichkeit, Pixel in einer vertikalen Stapelung anzuordnen, kann die Lichtempfindlichkeit und Auflösung maßgeblich gesteigert werden. Diese technische Innovation eröffnet neue Möglichkeiten sowohl für die Fotografie als auch für die maschinelle Bildverarbeitung in Medizin, Umwelt und Industrie. Auch wenn noch technische Herausforderungen bestehen, sind die ersten Ergebnisse vielversprechend und prognostizieren eine Zukunft, in der Bildsensoren noch leistungsfähiger, flexibler und kosteneffizienter sein werden.