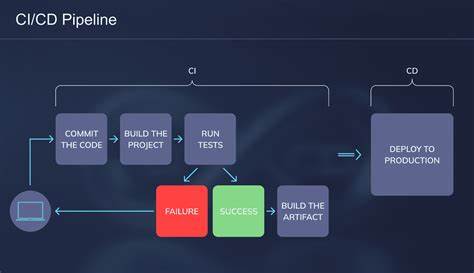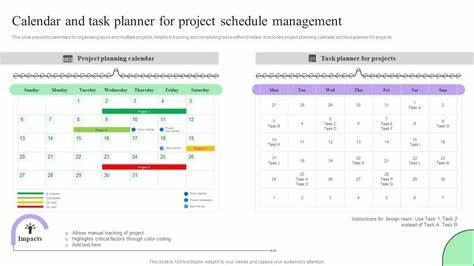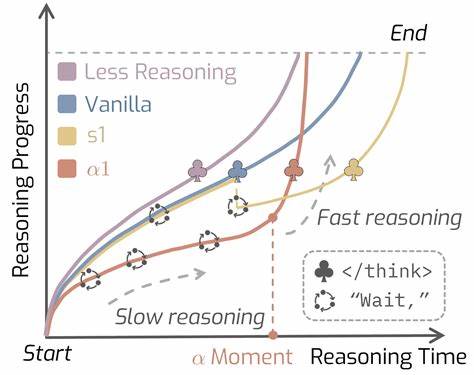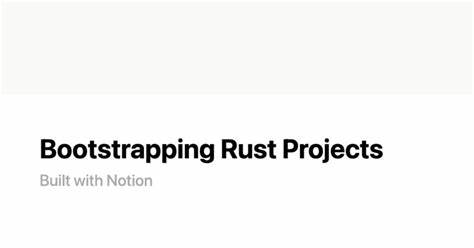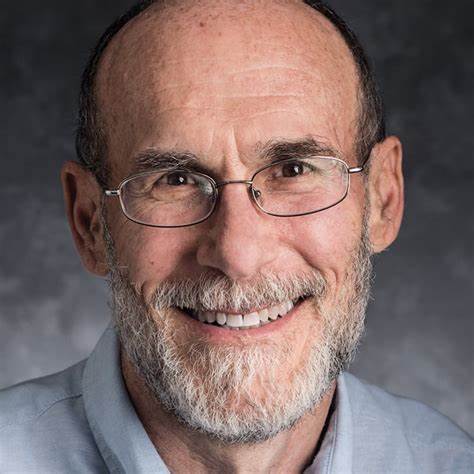Die Erforschung von Farbzentren in Diamanten hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Thema in der Quantenoptik und Nanophysik entwickelt. Besonders die Farbzentren der sogenannten Gruppe IV – also Zentren, die einander ähnlich sind, weil sie Elemente wie Zinn (Sn), Silizium (Si), Germanium (Ge) oder Blei (Pb) im Kristallgitter des Diamanten integrieren – bieten enorme Potenziale für Anwendungen in Quantenkommunikationsnetzwerken, ultrasensitiven Sensoren und Quantencomputern. Dabei ist die Fähigkeit, diese einzelnen Defekte präzise zu positionieren und optisch zu aktivieren, entscheidend für eine realisierbare und skalierbare Technologie. Ein neuer Durchbruch stellt die laserbasierte Aktivierung einzelner Gruppen-IV-Farbzentren in Diamant dar, bei der mit hochauflösender Ionimplantation gekoppelt eine gezielte und effiziente Erzeugung von Defekten gelingt. Farbzentren in Diamant sind atomare Defekte, die einzelne Atome oder Atomgruppen im Kristallgitter ersetzen oder fehlende Atome darstellen.
Diese Defekte sind wegen ihrer einzigartigen optischen und elektronischen Eigenschaften faszinierend: Sie können einzelne Photonen emittieren, besitzen gut definierte Quantenzustände und können bei niedrigen Temperaturen Kohärenzzeiten aufweisen, die für Quantenanwendungen essenziell sind. Die klassischen Farbzentren in Diamant waren bislang vor allem die Stickstoff-Fehlstellen-Zentren (NV−), die trotz langer Kohärenzzeiten einigen Einschränkungen unterliegen, insbesondere hinsichtlich ihres optischen Signals und der Empfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen nahe der Oberfläche. Hier setzen die Farbzentren der Gruppe IV an. Dank ihrer krystallographischen Inversionssymmetrie zeigen sie eine dominierende Emission in der sogenannten Null-Phonon-Linie (Zero-Phonon Line, ZPL), reduzieren spektrale Diffusion merklich und bieten insgesamt stabilere optische Erscheinungsbilder. Unter ihnen punktet das Zinndotierte Farbzentrum (SnV−) durch optimalen Spin-Bahn-Kopplungseffekte, die zum Schutz der Kohärenz bei tiefen Temperaturen beitragen und gleichzeitig eine praktikable magnetische Steuerung erlauben.
Dies macht SnV− zu einem begehrten Kandidaten für die Integration in Quantenhardware. Eine der zentralen Herausforderungen bei der Nutzung dieser Farbzentren ist die präzise Herstellung und Aktivierung einzelner Farbzentren an definierten Orten im Diamantkristall. Klassische Methoden wie chemische Gasphasenabscheidung (CVD) oder Hochdruck-Hochtemperatur-Synthese (HPHT) erlauben zwar die Erzeugung qualitativ hochwertiger Zentren, versagen jedoch bei der zielgerichteten Defektplatzierung. Ionimplantation dagegen bietet eine bis zu 50 Nanometer präzise Positionierung. Sie ist jedoch problematisch hinsichtlich des Eintrags von Gitterstörungen, die die optischen und spinphysikalischen Eigenschaften der Zentren negativ beeinflussen.
Neue Erkenntnisse zeigen, dass eine Kombination aus site-selektiver Ionimplantation und einer darauffolgenden ultrakurzen Femtosekunden-Laserannealung mit in-situ-Spektralkontrolle das Problem der Defektaktivierung elegant löst. Dabei werden im ersten Schritt einzelne 117Sn-Ionen mit einer Auflösung von unter 50 Nanometern impliziert, die Anzahl der implantierten Ionen pro Stelle wird vom Bereich hunderter bis einzelner Ionen variiert und kontrolliert. Anschließend erfolgt die Aktivierung des Farbzentrum mittels in-situ Überwachung der Photolumineszenz während der Laserbehandlung, was erstmals ein hochpräzises Nachverfolgen und kontrolliertes Schalten der Defekte erlaubt. Die Laserannealung nutzt ultrakurze Laserpulse mit einer Pulsdauer von etwa 400 Femtosekunden und einer Wellenlänge von 520 Nanometern, die lokal auf die Implantationsstellen fokussiert werden. Diese Methode vermeidet den thermischen Stress und die Oberflächenschädigung, die bei herkömmlichen Hochtemperaturanwendungen auftreten, und aktiviert dennoch effizient SnV− Farbzentren.
Ein wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, die photolumineszenten Eigenschaften im Prozess laufend zu messen und so aktivierte Zentren unmittelbar zu identifizieren und den Prozess optimal zu steuern. Experimentelle Ergebnisse belegen die erfolgreiche Erzeugung einzelner SnV− Farbzentren mit einem charakteristischen Photolumineszenz-Nullphononlinienpeak bei etwa 619 Nanometern. Bei tiefen Temperaturen spaltet sich die ZPL in zwei eng benachbarte Übergänge (γ und δ), die für die elektronische Struktur des SnV− typisch sind. Zweitkorrelationsmessungen der Photonenentwicklung bestätigen die Einzelexemplar-Natur dieser luminiszenten Zentren – ein entscheidender Punkt für Anwendungen in der Quantenoptik, bei denen einzelne Photonenquellen erfordert werden. Neben den SnV− Zentren wurde während der Aktivierung auch ein zuvor wenig verstandenes Sn-bezogenes Defektkomplex mit einer Null-Phonon-Linie um 595 Nanometer entdeckt, der als „Type II Sn“ bezeichnet wird.
Untersuchungen und Hochauflösungs-Spektroskopie an einzelnen Type-II-Sn-Zentren zeigen, dass sie sich in ihrer spektralen Verteilung und Polariationsabhängigkeit deutlich vom SnV− unterscheiden. Dichtefunktionaltheoretische Rechnungen legen nahe, dass es sich hierbei um SnV− Zentren handelt, die an ein Kohlenstoff-Self-Interstitial gebunden sind – also um einen komplexeren Defekt, der eine Zwischenstufe oder einen Vorläufer für das aktivierte SnV− darstellen könnte. Spannend sind auch die dynamischen Wechselwirkungen zwischen den Defektzuständen während der Laseraktivierung. Die spektrale Überwachung zeigt reversible Übergänge zwischen Type II Sn und SnV− Emissionslinien. Das bedeutet, dass der Laserprozess in der Lage ist, die Defektkonfigurationen zu verändern, indem Kohlenstoffinterstitielle mobilisiert und umlagerungen im Kristallgitter ausgelöst werden.
Dies gibt bislang ungekannte Einblicke in die Aktivierungsmechanismen und eröffnet Wege zur gezielten Defektmodifikation. Aus technischer Sicht stellt diese Methode einen großen Fortschritt dar, da sie lokale, schnell durchführbare und hochauflösende Aktivierung mit skalierbarer Präzision verbindet. Die Möglichkeit der „on-demand“-Erzeugung einzelner Farbzentren ohne komplette Hochdruck-Hochtemperaturbehandlungen macht den Prozess kompatibel mit moderner Nanofabrikation und Design komplexer Quantengeräte. Ebenso bietet die in-situ-Überwachung eine vielversprechende Kontrollinstanz für zukünftige automatisierte Fertigungsverfahren. Weiterhin wurden Polariationsmessungen durchgeführt, die die typischen, kristallographisch definierten Übergangsmerkmale der Gruppe-IV-Zentren bestätigen.
Dies ist nicht nur ein Beleg für die Identifikation der erzeugten Defekte, sondern auch Grundlage für deren gezielte Ansteuerung in optischen Quantennetzwerken, in denen Polarisation eine Steuerungs- und Kodierungsgröße darstellt. Während sich die vorgestellte Arbeit primär mit SnV− Zentren befasst, lässt sich das Vorgehen grundsätzlich auf andere Farbenzentren und Wirtsmaterialien mit breitem Bandabstand übertragen. Erste Experimente zeigen auch vielversprechende Ergebnisse bei der Aktivierung von SiV− Zentren nach Implantation und Laserbehandlung. Damit eröffnet sich ein neues Feld für die hochpräzise Defektmanipulation in Halbleitermaterialien. Zusammenfassend markiert die laserbasierte Aktivierung einzelner Gruppen-IV-Farbzentren in Diamanten einen signifikanten Schritt hin zu skalierbaren, kontrollierten Quantenhardware-Plattformen.