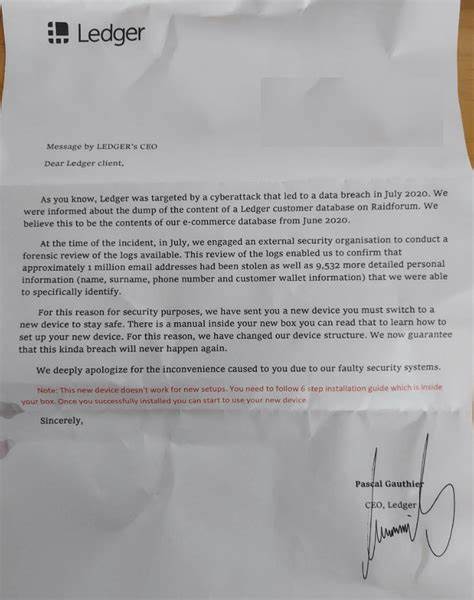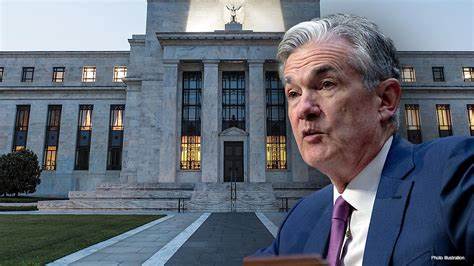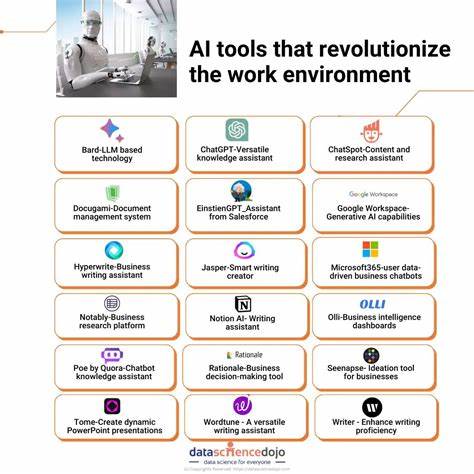In den letzten Jahren hat sich ein spürbarer Widerstand gegen die allgegenwärtige Produktivitätskultur entwickelt, besonders unter Wissensarbeitern. Die Erwartung, ständig mehr zu leisten, effizienter zu arbeiten und die Zeit optimal zu nutzen, führt für viele zu einem Gefühl der Erschöpfung und Überforderung. Dieses Phänomen wurde vor allem während der Pandemiezeit verstärkt sichtbar, als plötzlich Arbeits- und Privatleben stark miteinander verschmolzen und die Grenze zwischen beidem immer unschärfer wurde. Doch woher rührt die Unzufriedenheit mit dem Begriff „Produktivität“ und warum empfinden immer mehr Menschen die obligate Leistungssteigerung als belastend? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf die Entstehung und Entwicklung des Produktivitätsbegriffs sowie die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, die mit ihm einhergehen. Der Ausdruck „Produktivität“ hat eine lange Geschichte, die bis zu Adam Smith und seinem Werk „Der Wohlstand der Nationen“ zurückreicht.
Smith definierte produktive Arbeit als jene, die einen Mehrwert schafft – etwa wenn ein Tischler aus einzelnen Holzteilen ein Möbelstück anfertigt, dessen Wert über dem der Rohmaterialien liegt. Diese ursprüngliche Definition sah Produktivität vor allem in wirtschaftlicher Wertschöpfung. Mit der Weiterentwicklung der Ökonomie wandelte sich Produktivität zu einer messbaren Beziehung zwischen Output und Input, sprich wie viel Leistung oder Wert in Relation zu den eingesetzten Ressourcen erzeugt wird. Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene sind Produktivitätssteigerungen unerlässlich, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und den Lebensstandard zu erhöhen. So schrieb etwa Peter Drucker, dass die enorme Steigerung der Produktivität in der manuellen Arbeit im Verlauf des 20.
Jahrhunderts auch gesellschaftliche und technologische Fortschritte ermöglichte, an denen wir heute selbstverständlich Anteil haben. Traditionell erfolgte die Steigerung der Produktivität durch die Optimierung von Systemen und Prozessen. Beispiele finden sich in der Landwirtschaft mit dem vierfelddrehsystem des 17. Jahrhunderts oder in der industriellen Produktion mit Henry Fords Fließbandfertigung. Dabei lag die Verantwortung für solche Optimierungen meist außerhalb der einzelnen Mitarbeiter: Die Prozesse wurden zentral verbessert, was für die Beschäftigten häufig eine Entfremdung ihrer Arbeit bedeutete.
Sie mussten sich den Vorgaben der Systeme fügen, ohne eigenen Einfluss auf diese Änderungen zu haben. Dennoch konnten durch diese optimierten Systeme enorme Effizienzgewinne erzielt werden. Das Bild änderte sich mit dem Aufkommen der Wissensarbeit. Ab etwa Mitte des 20. Jahrhunderts verlagerte sich das wirtschaftliche Zentrum von der industriellen Produktion hin zu kreativen und intellektuellen Tätigkeiten.
Die Herausforderung bestand nicht mehr in der reinen Prozessoptimierung, sondern darin, wie einzelne Wissensarbeiter ihre Arbeitszeit und Konzentration so gestalten können, dass sie produktiver werden. Diese Individualisierung der Produktivität bedeutet, dass der Druck zur Leistungssteigerung nicht mehr nur systemisch über Prozesse gegeben ist, sondern auf den Schultern des Einzelnen lastet. Statt auf das System kann man sich nicht mehr allein verlassen, sondern muss als Mitarbeiter seine eigene Produktivität optimieren. Diese Verschiebung trägt erheblich zur Überforderung bei vielen bei. Besonders problematisch ist, dass die Produktivität in der Wissensarbeit oft als eine unbegrenzte Größe verstanden wird – mehr Output ist immer besser.
Das führt zu einem inneren Konflikt, da Stunden für Familie, Freizeit oder Erholung für die Arbeit geopfert werden müssen, um den immer höheren Anforderungen gerecht zu werden. Dieses ständige Streben nach mehr erzeugt nicht nur Stress, sondern auch Schuldgefühle gegenüber den eigenen Bedürfnissen. Die dadurch entstehende psychische Belastung zeigt sich in der wachsenden Zahl der Burnout-Fälle und anderen stressbedingten Erkrankungen. In der Kritik an der Produktivitätskultur kristallisieren sich daher zwei zentrale Punkte heraus: Erstens die Überforderung durch die Individualisierung der Leistungssteigerung und zweitens die problematische gesellschaftliche Verknüpfung von Leistung mit persönlichem Wert oder moralischer Integrität. Viele Stimmen fordern deshalb, das Konzept neu zu denken oder zumindest sprachlich zu entkoppeln von der ständigen Selbstoptimierung und der Erwartung, dass Wertschöpfung nur durch maximale Produktivität erreicht wird.
Ein wichtiger Beitrag zur Debatte waren Bücher wie „How to Do Nothing“ von Jenny Odell, „Do Nothing“ von Celeste Headlee oder „Can’t Even“ von Anne Helen Petersen, die unterschiedliche Perspektiven auf die Problematik der Überarbeitung und der erschöpften Gesellschaft bieten. Diese Werke vereint eine gemeinsame Ablehnung der entfesselten Produktivitätserwartung und plädieren für mehr Raum für Ruhe, Reflexion und sinnhaftes Tun abseits von Leistungszwang. Ihre oftmals persönlichen Erzählungen machen deutlich, dass es sich hier nicht um ein theoretisches Problem handelt, sondern um eine Erfahrung, die viele Menschen unmittelbar betrifft und deren Folgen auch gesundheitlich spürbar sind. Die Pandemie war dabei wie ein Katalysator, der die Spannungen der Produktivitätskultur noch deutlicher zutage treten ließ. Während viele Unternehmen während des Lockdowns versuchten, ihre Mitarbeiter weiterhin zu maximaler Leistung anzuspornen, wuchs bei den Betroffenen das Gefühl, dass die Anforderungen oft an den Kräften zehren und nicht das Gesamtwohl im Blick haben.
Zahlreiche Stimmen kritisierten, dass die Aufforderungen, “produktiv” zu bleiben, häufig auf Kosten des emotionalen und sozialen Lebens gehen und eine Herausforderung darstellen, die kaum zu bewältigen ist, wenn gleichzeitige Belastungen etwa durch Homeschooling, familiäre Verpflichtungen und existentiale Ängste hinzukommen. Angesichts dieser Herausforderungen ist eine Rückbesinnung auf die Geschichte der Produktivität hilfreich, um den Fokus neu zu setzen. Produktivität als wirtschaftliches Konzept ist nicht per se negativ, denn sie ermöglicht Wohlstand und Fortschritt. Das Problem liegt vielmehr darin, dass das gesamte individuelle Leben darauf ausgerichtet wird, und dass eigenverantwortliche Optimierung einseitig die Lasten auf die Mitarbeiter verschiebt. Die Lösung könnte darin bestehen, Produktivität wieder stärker als systemisches Ziel zu begreifen und die Verantwortung für deren Steigerung mehr auf organisationaler Ebene anzusiedeln.
Beispiele aus der Softwareentwicklung zeigen, wie agile Methoden wie Scrum oder Kanban durch organisierte Teamstrukturen und Prozesse effektivere und gleichzeitig menschengerechtere Arbeitsweisen ermöglichen, ohne den Einzelnen über Gebühr zu belasten. Wichtig dabei ist, die Balance zu finden zwischen angemessener Leistungssteigerung und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Das bedeutet auch, die Grenzen fasstbarer Produktivitätserwartungen zu akzeptieren und den Dialog zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten zu fördern. Nur so lassen sich Systeme schaffen, die effizientes Arbeiten unterstützen und gleichzeitig die psychische Gesundheit schützen. Auch die Möglichkeit, Überlastung zu thematisieren und Grenzen setzen zu können, ohne als faul oder unzuverlässig abgestempelt zu werden, ist ein entscheidender Fortschritt.
Individuelle Impulse zur Verbesserung, wie das Erlernen von Zeitmanagement, das Minimieren von Ablenkungen oder das bewusste Pausenmachen, bleiben weiterhin sinnvoll. Doch sie sollten in einem Umfeld erfolgen, das die Rahmenbedingungen gestaltet und unterstützt anstatt zu überfordern. Damit Mitarbeiter ihre Fähigkeiten zur besten Leistung entwickeln können, muss der Fokus weg von „mehr und mehr“ gehen und hin zu Qualität, Zufriedenheit und Sinnstiftung am Arbeitsplatz sowie im Leben generell. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Frustration mit der Produktivitätskultur Ausdruck eines tief verwurzelten Problems ist, das nicht durch blinde Leistungssteigerung oder simple Selbstoptimierung zu lösen ist. Es braucht neue Denkweisen, die Produktivität als Teil eines größeren sozialen und ökonomischen Kontextes verstehen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen.
Dies erfordert Mut, Systeme zu verändern, realistische Erwartungen zu formulieren und eine Kultur des respektvollen Miteinanders zu etablieren. Nur so kann die Produktivität wieder zu einem positiven Motor werden, der Wohlstand und Lebensqualität hebt, ohne die Menschen zu erschöpfen oder auszubeuten. Indem wir das Verhältnis zwischen individueller Verantwortung und systemischer Organisation neu justieren, schaffen wir die Grundlage für eine nachhaltige und menschliche Arbeitswelt, die den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht wird.