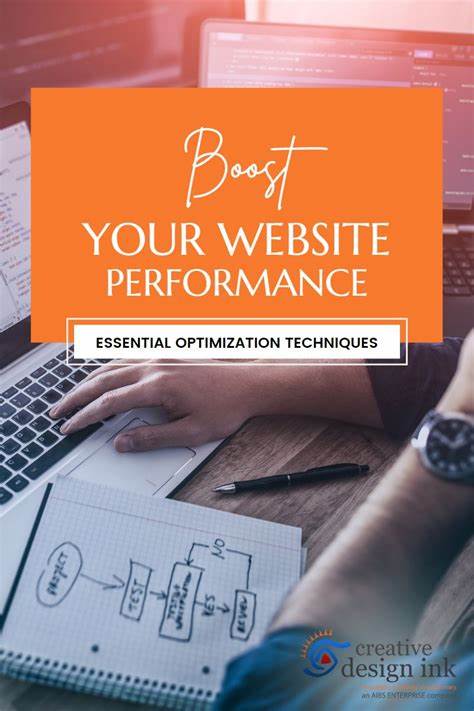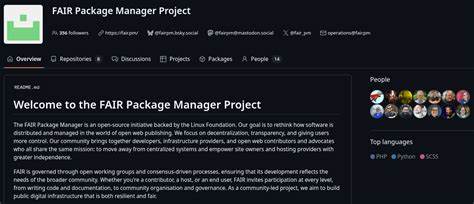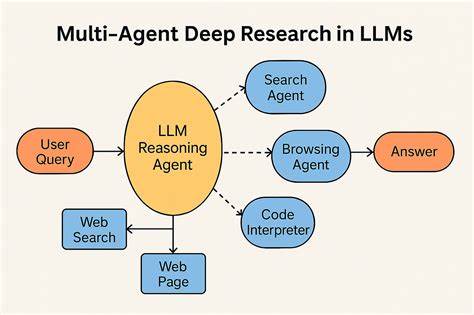Nach acht Jahren Entwicklungshistorie hat Nintendo mit der Switch 2 eine echte Hardware-Erneuerung vorgestellt. Die Konsole bietet einen schnelleren Prozessor, ein verbessertes Display sowie eine erhöhte Speicherkapazität von 256 GB mit UFS 3.1-Technologie. Obwohl diese technischen Verbesserungen beeindruckend sind, wirft die Frage nach der Reparaturfreundlichkeit des Geräts weiterhin Schatten auf das ansonsten positive Gesamtbild. Die ersten Einblicke ins Innenleben der Switch 2 enthüllen eine Mischung aus bewährten und kritikwürdigen Konstruktionsmerkmalen, die vor allem die Reparatur und Wartung erschweren.
Die Freude über Fortschritte wird schnell von Bedenken in Sachen Benutzerfreundlichkeit im Reparaturfall gedämpft. Eines der am meisten diskutierten Probleme im Kontext der Switch ist das sogenannte Joystick-Drifting – die ungewollte Bewegung der Analogsticks, die nicht nur bei Nintendo ein häufiges Problem darstellt. Die Switch 2 verwendet weiterhin Potentiometer-basierte Joysticks, deren Verschleißmechanismus und Anfälligkeit für Verschmutzungen bekannt sind. Auch wenn Nintendo Entwickler von neuen, driftresistenteren Technologien wie Hall-Effekt-Sensoren oder TMR (Tunneling Magnetoresistance) bewusst vermieden hat – letztere hätte bezüglich magnetischer Interferenzen durchaus Sinn ergeben –, bleibt die Grundproblematik bestehen. Die neuen Joy-Cons wurden zwar von Grund auf neu gestaltet, doch Technologien, die grundsätzlich dem Drift vorbeugen, wurden nicht integriert.
Die Reparatur des Joy-Con-Controllers gestaltet sich insbesondere durch versteckte Schrauben und den großzügigen Einsatz von Klebstoff komplizierter als erwartet. Die sogenannten Tri-Point-Schrauben, die charakteristisch für Nintendo sind, sind zwar von außen sichtbar, doch weitere Schrauben verstecken sich unter einer verklebten Kunststoffrippe, die ohne vorsichtiges Vorgehen schwer zu entfernen ist. Dieses Design erhöht nicht nur den Zeitaufwand beim Öffnen, sondern erhöht auch die Gefahr, das Gerät ungewollt zu beschädigen. Das Entfernen der Batterien gestaltet sich ähnlich schwierig, da diese mit stark haftendem Klebstoff befestigt sind. Zwar ist das Trennen der Batteriekabel unkompliziert, den Akku unbeschadet herauszunehmen erfordert jedoch viel Geduld und spezielles Werkzeug.
Dieses aggressive Klebeverfahren erschwert den Austausch von Verbrauchsteilen erheblich. Ein besonderes Ärgernis ist die Tatsache, dass wichtige Komponenten wie der Kartenschacht für die Spielmodule nicht mehr modular gestaltet, sondern fest mit dem Mainboard verlötet sind. Gleiches gilt für die zwei USB-C-Anschlüsse, die im Gehäuse der Switch 2 verbaut sind. Diese Soldered-Designs führen dazu, dass bei einem Defekt einzelner Bauteile oft ein aufwändiger und vor allem teurer Austausch des gesamten Mainboards nötig wird. Dies steht im deutlichen Gegensatz zu modulareren Geräten, bei denen einzelne Komponenten wie Buchsen oder Slots leicht gewechselt werden können.
Die Folge ist, dass Reparaturkosten und -aufwand für Endnutzer stark ansteigen und gleichzeitig der elektronische Müll zunimmt. Doch es gibt auch einige positive Aspekte, die Nintendo mit der Switch 2 beibehalten oder sogar verbessert hat. Zubehör wie der Kopfhöreranschluss und der microSD Express-Kartenleser sind weiterhin modular, wodurch sich diese Komponenten relativ einfach ersetzen lassen. Auch Mikrofon, Lüfter und Lautsprecher profitieren von einer modularen Bauweise, bei der sie an separaten Platinen angeschlossen sind. Der Lüfter ist dabei nicht nur gut zugänglich, sondern wird zudem mit Gummidämpfern montiert, die Geräusche minimieren.
Solche Entscheidung zeigt, dass Nintendo zumindest in einigen Bereichen Reparaturfreundlichkeit in Betracht zieht – wenn auch nur in begrenztem Maße. Das neue Display der Switch 2 bietet mit einer 7,9-Zoll-Diagonale, Full-HD-Auflösung, HDR-Unterstützung und 120 Hz eine technisch beeindruckende Wiedergabe. Um Schäden am Bildschirm vorzubeugen, hat Nintendo eine Kunststofffolie als Anti-Splitterschutz aufgebracht. Allerdings ist diese Folie anfällig für Kratzer und kann im Gebrauch schnell unansehnlich werden, besonders wenn kein offizieller Ersatz verfügbar ist. Die Nutzer müssen daher vorsichtig mit dem Display umgehen und eventuell Abstriche bei der Langlebigkeit machen.
Der Dock der Switch 2 ist auf den ersten Blick unspektakulär, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung aber als technisch ausgefeiltes Zubehör. Der USB-C-Port ist federnd aufgehängt, was eine passgenaue Verbindung auch bei ungenauem Einführen der Konsole ermöglicht und so Schäden vorbeugt. Zudem ist im Dock eine aktive Kühlung integriert, die das Gerät bei längeren Spielsessions optimal temperiert. Seine saubere Platinenbestückung und mechanische Konstruktion lassen vermuten, dass hier ein anderes Entwicklerteam am Werk war als beim Konsolen-Hauptgerät. Aus Sicht der Reparatur-Community ist vor allem die Geheimhaltung problematisch, da Nintendo bislang keine offiziellen Reparaturanleitungen oder Ersatzteile für die Switch 2 bereitgestellt hat.
Dieser Umstand erschwert den Besitzern die eigenständige Instandhaltung erheblich und zwingt sie oft in die teure Abhängigkeit vom Hersteller oder autorisierten Servicezentren. Zudem steht diese Praxis im Spannungsfeld zur Gesetzgebung, beispielsweise zum Right-to-Repair-Gesetz im US-Bundesstaat New York, das den Zugang zu Reparaturinformationen und Ersatzteilen vorschreibt. Verbraucherorganisationen und Reparaturexperten appellieren daher an Nintendo, hier mehr Transparenz und Unterstützung zu bieten. Mit all diesen Faktoren zusammengenommen zeigt die Einschätzung der Reparierbarkeit, dass die Switch 2 trotz vieler technischer Fortschritte nur begrenzte Verbesserungen in Sachen Reparaturfreundlichkeit bietet. Die Kombination aus verklebten Batterien, versteckten Schrauben, verlöteten Komponenten und fehlenden offiziellen Ersatzteilen führt zu einer Punktbewertung von nur 3 von 10 möglichen Punkten auf der Reparaturskala.
Dies bedeutet, dass Reparaturen für Laien sehr anspruchsvoll sind und auch erfahrene Techniker mit Vorsicht vorgehen sollten. Die Botschaft an Nintendo lautet daher klar: Die Bauteile modularer gestalten, weniger Klebstoff verwenden, die Verwendung von driftunempfindlicheren Joystick-Technologien überdenken und vor allem die Nutzer durch offizielle Reparaturunterlagen und verfügbare Ersatzteile unterstützen. Solange dies nicht geschieht, werden Third-Party-Reparatur-Kits und Anleitungen von Community-Plattformen weiterhin die wichtigsten Lösungen für eine lange Lebensdauer der Switch 2 bleiben. Insgesamt ist die Nintendo Switch 2 technisch ein großer Schritt nach vorne, doch die Reparaturfreundlichkeit bleibt weiterhin ein Schwachpunkt. Wer die Konsole besitzt oder sich für den Kauf entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass Reparaturen und Wartungen mit erheblichen Herausforderungen einhergehen können.
Eine solide Vorbereitung, der Einsatz geeigneter Werkzeuge und der Zugriff auf digitale Reparaturhilfen sind dabei unerlässlich. Nur so lässt sich die Freude an dem technisch hochwertigen Gerät langfristig erhalten und tragen gleichzeitig zu einer nachhaltigeren Nutzung bei.