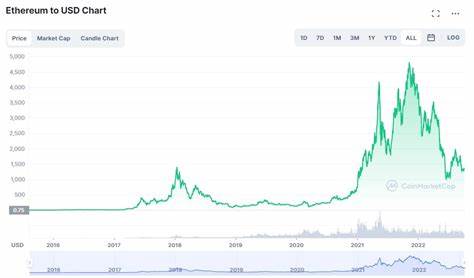Die jüngsten Aussagen von Dea Markova, Leiterin der Politikabteilung bei Fireblocks, haben einen bedeutenden Trend im Bereich der digitalen Währungen hervorgehoben: Die steigende Nachfrage nach Stablecoins, die nicht an den US-Dollar gebunden sind. Dieses Interesse zeigt sich besonders deutlich außerhalb der Vereinigten Staaten, wobei Länder wie Singapur und verschiedene europäische Staaten nach Alternativen suchen, die mehr finanzielle Souveränität bieten. Die Diskussion um nicht-dollarbasierte Stablecoins befasst sich weniger mit der Technologie selbst, sondern vielmehr mit geopolitischen und wirtschaftlichen Aspekten, die das globale Finanzsystem stärker prägen als bislang vermutet. Die Macht, die der US-Dollar bisher im weltweiten Zahlungsverkehr innehat, wird zunehmend infrage gestellt. Dabei verschiebt sich der Fokus nicht nur auf eine Dezentralisierung der Geldflüsse, sondern auch auf die Frage, wie viel Kontrolle nationale Staaten über ihre digitalen Währungen und die damit verbundenen Finanzinstrumente behalten können.
Markova beschreibt diese Entwicklung treffend als „Kampf um Souveränität“. Die Parallele zu früheren Konflikten zwischen Regierungen und großen amerikanischen Zahlungsdienstleistern wie Visa und Mastercard verdeutlicht, wie stabilcoins als neues Spielfeld für diese Auseinandersetzungen fungieren. Diese Dynamik hat wirtschaftspolitische Dimensionen, die weit über den Kryptomarkt hinausreichen. Ein zentraler Grund für die Skepsis gegenüber US-Dollar-Stablecoins in Europa ist die Abhängigkeit von US-Staatsanleihen (Treasury Bonds) als Sicherheitenbasis. Das birgt aus Sicht einiger Finanzregulierer ein systemisches Risiko, das sich negativ auf die Stabilität innerhalb der Eurozone auswirken könnte.
So hat etwa die Europäische Zentralbank (EZB) jüngst den Druck erhöht, die Entwicklung eines digitalen Euro zu forcieren. Dies soll nicht nur die Abhängigkeit von Dollar-basierten Stablecoins verringern, sondern auch die digitale Währungslandschaft innerhalb der EU harmonisieren und kontrollierbar machen. Ergänzend veröffentlichte die italienische Zentralbank im April 2025 einen Bericht, der auf die potenziellen Risiken dollarbasierter Stablecoins verweist. Neben regulatorischen Bedenken wird auch die limitiere Liquidität von nicht-dollargebundenen Stablecoins als Herausforderung genannt. Dennoch betont Markova, dass die Nachfrage nach solchen Stablecoins signifikant wächst und von Ländern aktiv vorangetrieben wird, die ihre Finanzsysteme von der Dominanz des US-Dollars befreien möchten.
Besonders interessant ist der Blick auf die Entwicklungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die im regulatorischen Umgang mit Stablecoins als Vorreiter gelten. Während die Regulierung in Europa häufig strikte Anforderungen an die lokale Lizenzierung und den Wohnsitz von Stablecoin-Anbietern stellt, verfolgt Abu Dhabi einen pragmatischeren Ansatz. Hier wird zunächst eine umfassende Due-Diligence-Prüfung von globalen Stablecoins vorgenommen, um dann zu entscheiden, welche davon auf lokalen Handelsplattformen angeboten werden können. Diese Offenheit fördert die Anbindung lokaler Unternehmen an globale Liquiditätsquellen und erleichtert grenzüberschreitende digitale Zahlungen. Im Dezember 2024 wurden USDT und USDC als anerkannte virtuelle Vermögenswerte in Abu Dhabi zugelassen, was das Vertrauen in diese Stablecoins auf institutioneller Ebene stärkt.
Gleichzeitig wird dort an der Entwicklung eines dirhamgebundenen, regulierten Stablecoins gearbeitet, der eine noch stärkere nationale Finanzsouveränität ermöglichen könnte. Die weltweite Dominanz der US-Dollar-Stablecoins – etwa Tethers USDT und Circles USDC – wird durch ihre Marktkapitalisierung untermauert, die mit knapp 211 Milliarden US-Dollar etwa 87 Prozent des gesamten Stablecoin-Marktes repräsentiert. Diese Übermacht macht das Interesse an Alternativen verständlich, auch wenn deren Marktanteile aktuell noch vergleichsweise gering sind. Die Suche nach nicht-dollarbasierten Stablecoins ist Teil eines größeren Trends zur Dekolonisierung der Finanzsysteme und zur Schaffung eines multipolaren digitalen Währungsmarktes. Die EU-Erweiterung der digitalen Euro-Strategie zielt darauf ab, eigene Lösungen zu entwickeln, die nicht nur regulatorisch kompatibel sind, sondern auch das Vertrauen von Verbrauchern und Institutionen gewinnen.
Gleichzeitig reflektieren die regulatorischen Innovationen in den VAE eine Bereitschaft, flexibel auf die sich ändernden Marktbedingungen zu reagieren und globale Entwicklungen zu integrieren. Steigende geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit dem US-Dollar als Leitwährung befeuern zusätzlich die Nachfrage nach Stablecoins, die lokale Währungen repräsentieren oder nicht direkt an den Dollar gekoppelt sind. Diese Stablecoins könnten eine Schlüsselrolle bei der internationalen Diversifizierung von Zahlungsmitteln spielen und so das Finanznetzwerk stabiler und widerstandsfähiger machen. Außerdem erlauben sie Ländern, die unter US-Sanktionen leiden oder deren Währungen stark schwanken, einen stabileren Zugang zum globalen Handel und digitalen Finanzmarkt. Die Zukunft der nicht-dollarbasierten Stablecoins hängt stark von regulatorischen Rahmenbedingungen, der Liquiditätsbereitstellung und technologischen Innovationen ab.
Länder und Finanzinstitute investieren zunehmend in die Erforschung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) und in die Integration von Stablecoins in bestehende Zahlungssysteme. Dadurch entstehen hybride Modelle, die die Vorteile von Stabilität, Geschwindigkeit und Datenschutz kombinieren. Einheitliche Standards und internationale Zusammenarbeit werden entscheidend sein, um das volle Potenzial dieser Technologien zu erschließen und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Insgesamt markiert die wachsende Nachfrage nach nicht-dollarbasierten Stablecoins eine Wende in der globalen Finanzarchitektur. Sie weist darauf hin, dass traditionelle Machtstrukturen durch technologische Innovationen und geopolitische Interessen herausgefordert werden.
Während US-Dollar-Stablecoins nach wie vor dominieren, zeigen Entwicklungspfade in Europa, Asien und dem Nahen Osten, dass alternative digitale Währungen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Diese Veränderungen versprechen mehr Vielfalt und Stabilität im globalen Zahlungsverkehr sowie neue Möglichkeiten für Unternehmen und Verbraucher weltweit. Der Kampf um digitale Finanzsouveränität wird somit zu einem der zentralen Themen der kommenden Jahre und prägt die Agenda von Regulatoren, Investoren und Technologieentwicklern gleichermaßen.