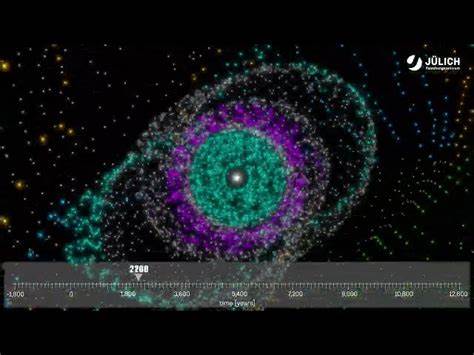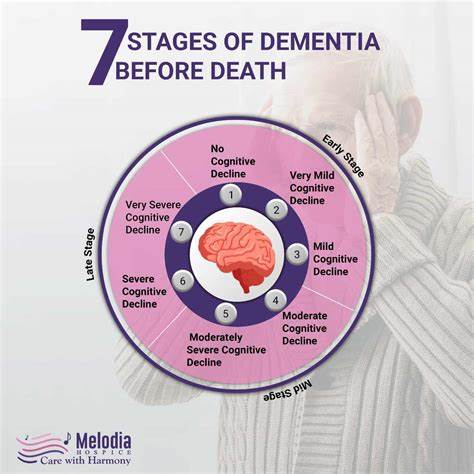Das Universum ist ein dynamischer Ort, in dem alles bewegt wird, sich wandelt und gegenseitig beeinflusst, auch wenn unser Alltag oft von scheinbarer Stabilität geprägt ist. Die Erde folgt ihrer Umlaufbahn um die Sonne, Jahreszeiten wechseln und das Klima zeigt langfristige Veränderungen. Doch wie stabil ist dieses Gefüge wirklich? Haben vorüberziehende Sterne, die sogenannten stellar flybys, im Laufe der Erdgeschichte die Umlaufbahn der Erde und damit das Klima beeinflusst? Dieser Frage widmen sich Wissenschaftler derzeit mit großem Interesse und bringen neue Erkenntnisse hervor, die unser Verständnis der Erdklimageschichte erweitern. Stellare Flybys beschreiben das Phänomen, wenn ein Stern in relativer Nähe an unserem Sonnensystem vorbeizieht. Obwohl unsere galaktische Nachbarschaft vergleichsweise dünn besiedelt ist, sind solche Vorbeiflüge nicht gänzlich selten.
Ein besonders bekanntes Beispiel hierfür ist der Vorbeiflug von Scholz' Stern vor etwa 70.000 Jahren, als dieses Doppelsternsystem durch die äußere Oortsche Wolke zog – eine Ansammlung von Kometen und eisigen Kleinkörpern am Rand unseres Sonnensystems. Die Schwerkraft des Sterns könnte einige dieser Objekte aus ihrer Bahn gebracht haben, doch es dauert viele Tausend Jahre, bis diese potenziell destabilisierten Kometen die innere Region des Sonnensystems erreichen. Die zentrale Fragestellung lautet, ob solche Stellarvorbeiflüge nicht nur Einfluss auf kleine Körper im Sonnensystem, sondern auch direkte Veränderungen an den Planetenbahnen hervorgerufen haben. Insbesondere interessiert die Wissenschaft, ob dadurch die Erdumlaufbahn oder die Neigung der Erdachse hinreichend verschoben wurden, um signifikante klimatische Auswirkungen zu verursachen.
Dies könnte erklären, warum es beispielsweise im Paläozän-Eozän-Thermalmaximum (PETM) vor rund 56 Millionen Jahren zu einem massiven globalen Temperaturanstieg von bis zu 8 Grad Celsius kam. Das PETM zeichnet sich durch eine rasche, über 10.000 bis 20.000 Jahre verlaufende Erwärmung aus, gefolgt von einer relativ langen Phase erhöhter Temperaturen über mehrere 100.000 Jahre.
Die Ursachen dieses Ereignisses sind bis heute umstritten. Hypothesen reichen von gewaltigen vulkanischen Ausbrüchen über Kometeneinschläge bis hin zur Freisetzung großer Mengen Methan aus Meeresböden. Auch die sogenannte Orbitalzwang-Hypothese wird diskutiert: Änderungen der Erdumlaufbahn könnten durch gravitative Wechselwirkungen ausgelöst worden sein. Ob aber Stellarvorbeiflüge eine wesentliche Rolle spielten, war bisher unklar. Die Forschung zeichnet hier ein komplexes Bild.
Frühere Studien etwa von Kaib und Raymond haben nahegelegt, dass nahe Passagen von Sternen die Umlaufbahnen insbesondere der Riesenplaneten gravierend beeinflussen können. Diese wiederum könnten dann ihre Umgebung, also auch die inneren Planeten wie die Erde, durch komplexe Wechselwirkungen in eine instabilere Bahn zwingen. Solche Szenarien zeigen, dass der Einfluss passierender Sterne auf lange Sicht nicht auszuschließen ist. Dem gegenüber steht eine neuere, besonders umfassende Studie von Richard Zeebe von der Universität Hawaii und David Hernandez von der Yale University. Sie nutzten fortschrittliche Simulationsmodelle, welche die gesamte Dynamik und auch wichtige sekundäre Effekte abbilden, beispielsweise die stabilisierende Wirkung des Mondes und spezielle Gravitationsmomente der Sonne.
Mit rund 400 Computersimulationen und 1.800 simulierten Sternvorbeiflügen über die letzten 56 Millionen Jahre kamen sie zu einem überraschenden Ergebnis: Stellarvorbeiflüge zeigen keine nachweisbare Auswirkung auf die Rekonstruktion des Erdklimas innerhalb dieses Zeitfensters. Ein wichtiger Grund für die unterschiedlichen Resultate liegt in der Detailtiefe der Modelle. Ältere oder vereinfachte Modelle schlossen oft den Einfluss des Mondes aus oder berücksichtigen nicht alle Planeten und sekundären Gravitationsfaktoren. Gerade der Mond hat aber stabilisierende Effekte auf die Erdumlaufbahn, was zu einem ruhigeren orbitalen Verhalten führt und die Wahrscheinlichkeit gravierender Verwerfungen verringert.
Zeebe und Hernandez betonen, dass durch die umfassendere Modellierung die Annahme, Sternvorbeiflüge seien ein wesentlicher Treiber von großen Klimaänderungen wie dem PETM, deutlich schwächer wird. Auch extrem nahe Sternvorbeiflüge halten sie für wenig einflussreich auf das Erdklima, zumindest über den betrachteten Zeitraum. Trotzdem bleibt die Rolle von Stellarflybys in anderen Bereichen des Sonnensystems relevant. Die Oortsche Wolke könnte durch Vorbeiflüge verstärkt destabilisiert werden, was langfristig Kometenschwärme in das innere Sonnensystem schickt. Einige Forscher spekulieren, dass diese Kometenströme potenziell aber erst in Millionen von Jahren auf der Erde Auswirkungen zeigen könnten.
Ein bevorstehendes Beispiel ist der Stern Gliese 710, der innerhalb von etwa 1,3 Millionen Jahren der Sonne sehr nahe kommen wird. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er die Oortsche Wolke durchquert und damit eine Vielzahl von Kometen auf neue Bahnen lenkt. Ob diese zukünftige Begegnung tatsächlich einen Einfluss auf das Erdklima haben wird, lässt sich aktuell nicht mit Sicherheit sagen. Die Komplexität trägt dazu bei, dass präzise Vorhersagen schwer sind. Wissenschaftler sind sich einig, dass jedes Verständnis vom Einfluss Stellarer Flybys auf das Klima von der Qualität der zugrundeliegenden Modelle abhängt.
Nur durch die vollständige Einbeziehung aller relevanten physikalischen Einflüsse – von den großen Planeten bis zum Luna-Effekt – lassen sich verlässliche Aussagen treffen. Die Debatte über den Einfluss vorüberziehender Sterne auf das Erdklima zeigt exemplarisch, wie interdisziplinäre Forschung moderne Fragestellungen angeht. Planetare Wissenschaft, Astronomie und Klimatologie verknüpfen sich dabei auf spannende Weise, um historische Klimaereignisse und Dynamiken besser zu verstehen. Gleichzeitig verdeutlicht sie, dass die Erde trotz lang stabiler Verhältnisse einem komplexen, dynamischen kosmischen Umfeld unterworfen ist. Zusammengefasst scheint der direkte Einfluss von Stellarflybys auf bedeutende Klimaereignisse der Erde, insbesondere innerhalb der letzten 56 Millionen Jahre, geringer zu sein als früher vermutet.