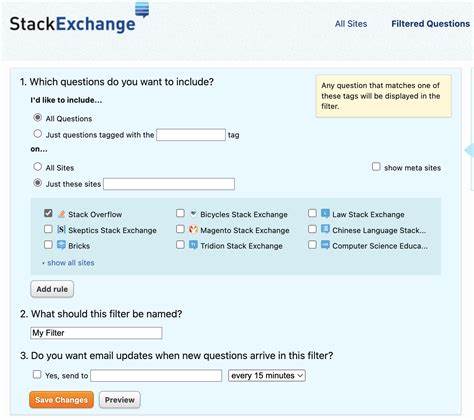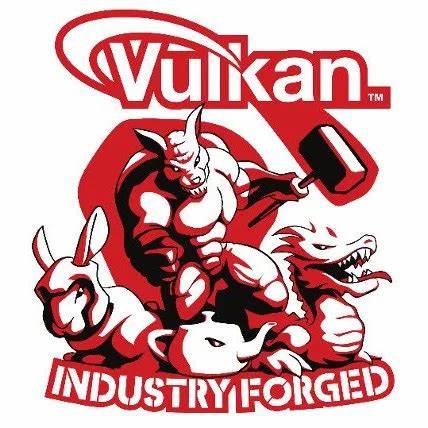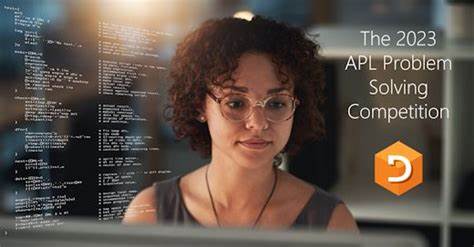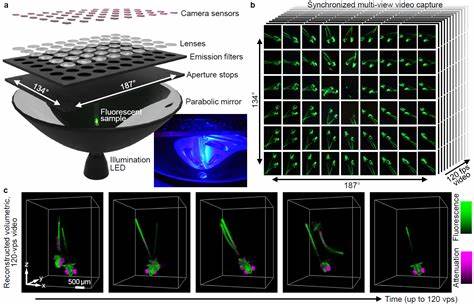Vor zehn Jahren erschütterte eine beispiellose Korruptionsaffäre den Weltfußball. Sieben hochrangige Offizielle der FIFA wurden in Genf verhaftet, ein Ereignis, das als historischer Wendepunkt für den Fußball-Weltverband gelten sollte. Viele hofften damals, dass die Organisation unter neuer Führung grundlegend reformiert und transparenter gestaltet werden würde. 2025 jedoch zeigt sich ein anderes Bild. Ein offener Brief von internationalen Fußballexperten, Rechtsexperten, Nichtregierungsorganisationen und Unterstützergruppen spricht Klartext: Die FIFA sei heute „arguably more poorly governed“ als noch vor einem Jahrzehnt.
Diese provokante Aussage mahnt zur dringenden Reflexion über die gegenwärtige Führung und Strategie der FIFA und wirft Fragen zur Zukunft des globalen Fußballs auf. Die Korruptionsskandale von 2015 waren nicht nur ein Schock für die Fußballwelt, sondern haben auch zu weitreichenden politischen und administrativen Veränderungen auf höchster Ebene geführt. Gianni Infantino, der 2016 das Präsidentenamt übernahm, versprach „eine neue Ära“ unter dem Motto, das Ansehen der FIFA wiederherzustellen und sie als glaubwürdigen, ethisch geführten Verband zu etablieren. Doch mittlerweile hat sich die Stimmung gewandelt. Statt Erfolgsmeldungen über Transparenz und Reformen findet sich vermehrt Unmut unter verschiedenen Akteuren des Fußballs: Fans, Verbände, Experten und Menschenrechtsorganisationen äußern Bedenken und Kritik an der aktuellen FIFA-Struktur.
Im Mittelpunkt der Kritik steht die sogenannte Machtbalance zwischen der Exekutive der FIFA und den Mitgliedsverbänden. Während die FIFA den Großteil ihrer Einnahmen an diese Verbände und Regionen weiterverteilt, gibt es kaum glaubwürdige Belege dafür, dass diese Mittel primär dem Spielentwicklungszweck dienen. Vielmehr wird vermutet, dass solche Finanzierungen vor allem dazu dienen, Loyalitäten zu sichern und Einfluss innerhalb der FIFA zu festigen. Dieses System stelle einen schlechten Anreiz für ethisches Verhalten dar und blockiere notwendige interne Reformen. Dabei ist die Idee einer gleichberechtigten und transparenten Zusammenarbeit als Basis für gesunde Verbandsführung essenziell – und offensichtlich in der FIFA noch nicht gegeben.
Weitere Kritikpunkte betreffen konkrete aktuelle Entscheidungen der FIFA, die widersprüchlich zum Anspruch einer verantwortungsvollen Führung stehen. Darunter fällt etwa die Einführung des Club-Weltcups im Sommer, ein Termin, der den ohnehin engen internationalen Spielkalender zusätzlich belastet. Auch die kontroverse Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien sorgt für erhebliche Diskussionen. Das Land steht wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen international massiv in der Kritik. Trotz dieser Umstände entschied die FIFA, diesem Staat eine der prestigeträchtigsten Fußballveranstaltungen der Welt zuzuerkennen – ein Schritt, der viele Beobachter als Verfehlung ethischer Grundsätze bewerten.
Auch mangelnde Transparenz bei Entscheidungsprozessen ist ein wiederkehrendes Thema. Die FIFA wird vorgeworfen, wichtige Vorgänge im Verborgenen abzuwickeln und damit Verantwortlichkeit erschweren. Diese Intransparenz erschüttert das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Fußballgemeinschaft. Die Nichtregierungsorganisation FairSquare, die den offenen Brief koordinierte, beschreibt die Situation als eindeutiges Zeichen dafür, dass die bisherigen Reformbemühungen unter der Präsidentschaft Infantinos gescheitert sind und die Organisation für die Herausforderungen des Weltfußballs strukturell ungeeignet bleibt. Zusätzlich zur Kritik an der Struktur wird auch die Kultur innerhalb der FIFA als unzureichend und problematisch eingeschätzt.
Bonita Mersiades, eine derjenigen, die einst den FIFA-Skandal aufdeckten, erläutert, dass sich die kulturelle Grundhaltung seit der Ära Blatter kaum verändert habe. Während damals Missstände offen zu Tage traten und Reformen verhindert wurden, meinen heutige Beobachter, dass Prozessoptimierung und neue Regularien allein nicht ausreichen, um tief verwurzelte kulturelle Probleme zu beheben. Wahre Reformen benötigten eine neue Wertebasis. Solange sich diese nicht etabliert, wird die Organisation immer wieder in ähnliche Krisen geraten. Die FIFA selbst verweist auf positive Entwicklungen der letzten Jahre.
So betont ein Sprecher, dass die Zusammenarbeit mit den US-Behörden, die damals die Korruptionsvorwürfe aufdeckten, die Organisation grundlegend verändert habe. Intern seien finanzielle Governance-Standards verbessert worden, und externe Fachverbände, etwa die Association of Summer Olympic Federations, hätten Transparenz und gute Führungspraktiken gelobt. Darüber hinaus sei das Investment in die weltweite Fußballentwicklung in den vergangenen zehn Jahren auf das Siebenfache gestiegen. Diese Punkte zeigen, dass die FIFA durchaus Fortschritte gemacht hat. Gleichzeitig reicht dies vielen Kritikern nicht aus, da die Ergebnisse und die Wirkung der Reformen von der Fußballwelt nicht als zufriedenstellend empfunden werden.
Die Frage steht im Raum, ob die FIFA überhaupt in der Lage ist, sich selbst ausreichend zu kontrollieren und effektiv zu steuern. Die enge Verflechtung mit den Mitgliedsverbänden und der erhebliche Einfluss einzelner mächtiger Akteure erschweren Reformen. Es zeigt sich, dass die professionelle und ethische Führung eines globalen Sportverbandes nicht allein durch neue Statuten oder Richtlinien gewährleistet werden kann, sondern tiefgreifende kulturelle und strukturelle Veränderungen benötigt. Die FIFA steht global in der Verantwortung, nicht nur als Sportorganisation funktionieren, sondern auch als Vorbild in Sachen Transparenz, Gerechtigkeit und Menschenrechte auftreten. Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, der Spieler und der Fans weltweit hängt von der Integrität und Glaubwürdigkeit des Verbandes ab.
Wenn die FIFA weiterhin als korruptionsanfällig wahrgenommen wird und politische oder wirtschaftliche Interessen über ethische Grundsätze gestellt werden, könnte dies den gesamten Fußball als Sport und Kultur nachhaltig beschädigen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie die FIFA auf die aktuellen Forderungen und die Kritik reagieren wird. Der offene Brief hat dabei nicht nur eine Momentaufnahme geliefert, sondern die Diskussion über den Weg der Organisationsentwicklung in den nächsten Jahren neu entfacht. Eine grundlegende Reform, die die Machtverhältnisse vernünftig regelt, nachhaltige ethische Werte etabliert und echte Transparenz schafft, scheint unerlässlich, wenn die FIFA ihre Rolle als weltweiter Fußballverband ernst nehmen will. Andernfalls droht eine weitere Erosion des Vertrauens, die letztlich die globalste aller Sportarten beeinträchtigen könnte.
Insgesamt zeichnet sich ab, dass die Herausforderungen der FIFA weit über einfache Verwaltungsfragen hinausgehen. Es geht um einen kulturellen Wandel, der tief verwurzelte Machtstrukturen hinterfragt und mutige Entscheidungen fordert. Erst wenn diese Elemente zusammenspielen, hat die Organisation eine realistische Chance, ihre Mission, den Fußball weltweit zu fördern und fair zu gestalten, erfolgreich zu erfüllen.