Die deutsche Geschichte ist tief geprägt von den Ereignissen des Nationalsozialismus, und doch wirken die Nachwirkungen dieser Zeit nicht nur politisch oder gesellschaftlich, sondern auch in der ganz privaten Lebenswelt vieler Menschen nach. Besonders auffällig ist dies im Bereich der Kindeserziehung, wo die rigiden und oftmals gefühllosen Richtlinien der NS-Zeit auch Jahrzehnte später noch emotionalen Einfluss auf einzelne Familien und sogar ganze Generationen haben können. Die Erziehungslehren von Johanna Haarer, einer Ärztin ohne pädiatrische Ausbildung, die während der NS-Zeit zur bekanntesten deutschen Expertin in der Säuglingspflege avancierte, spielten hierbei eine entscheidende Rolle. Ihre Bücher, insbesondere „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“, wurden millionenfach verbreitet, galten als Standardwerke und prägten zahlreiche deutsche Familien.*Haarers Leitlinien propagierten ein kaltes, distanziertes Verhalten gegenüber Kleinkindern und forderten Mütter auf, die emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder zu ignorieren.
Ziel war nicht, fürsorgliche, empathische Menschen zu erziehen, sondern „harte“ Kinder, die später als Soldaten und Anhänger des Regimes funktionieren sollten. Diese emotionale Kargheit richtete sich vor allem gegen das bindeorientierte Verhalten, das heute als besonders wichtig für eine gesunde kindliche Entwicklung betrachtet wird.Die Auswirkungen dieser Kindheitserfahrungen zeigen sich bis heute in Deutschland. Besonders auffällig ist das verbreitete Phänomen emotionaler Distanz sowie ein tief verwurzeltes Gefühl, Zuneigung nicht zuzulassen oder schwierige Gefühle herauszuhalten. Viele Psychotherapeuten berichten von Generationen, die den Kreislauf dieser verinnerlichten Muster kaum durchbrechen können.
Der Fall von Renate Flens, einer Frau, die in den 1960er-Jahren geboren wurde, ist hier beispielhaft. Trotz ihres starken Wunsches, Liebe zu fühlen und zu geben, gelingt es ihr nicht, eine enge Bindung zu ihren Kindern aufzubauen. Das Kindheitserbe von strenger Vernachlässigung emotionaler Nähe hat sich regelrecht in ihr Gehirn eingeprägt und beeinflusst auch ihr Verhalten als Mutter.*Warum erfreuten sich Haarers Lehren überhaupt einer solch großen Beliebtheit? Die NS-Ideologie war auf Gehorsam, nationalistische Härte und einen kompromisslosen Willen zur Macht fokussiert. Weibliche Ideale wurden auf die Rolle der perfekten Mutter und Hüterin der deutschen Volksgemeinschaft reduziert.
Junge Frauen, oft von eigenen emotionalen Verletzungen geplagt und durch Kriegstraumata geprägt, fanden in Haarers Empfehlungen scheinbar klare Orientierung in einer unsicheren Zeit. Das Gefühl, Härte beweisen zu müssen und keine Schwäche zeigen zu dürfen, war tief verwurzelt und wurde durch gesellschaftlichen Druck noch verstärkt.Aus heutiger Sicht zeigen wissenschaftliche Studien, wie wichtig eine feinfühlige, liebevolle und beständige Bindung für die Entwicklung von Kindern ist. Neurobiologische Untersuchungen belegen, dass die frühe Beziehung zum primären Bezugspersonen maßgeblich die Fähigkeit zur Emotionsregulierung und zur sozialen Interaktion prägt. Eingebettet in ein Umfeld von Vernachlässigung und emotionaler Kälte entwickeln Kinder häufig unsichere Bindungsstile.
Sie sind weniger in der Lage, Nähe zuzulassen und verarbeiten Stress und Belastungen schlechter. Psychologische Forschungen und Langzeitstudien belegen, dass stressbedingte Hormonreaktionen und genetische Veränderungen sogar epigenetisch weitergegeben werden können, also über mehrere Generationen hinweg Einfluss nehmen.Die weitreichenden Folgen eines solchen Erziehungsstils zeigen sich nicht nur auf individueller Ebene. In Deutschland gibt es kulturelle Merkmale, die sich möglicherweise aus dieser emotionalen Prägung erklären lassen. Es sei beispielsweise die Präferenz für emotionale Zurückhaltung, die in der Erziehung als „Unabhängigkeit“ interpretiert wird, jedoch oft emotionalen Abstand statt Nähe bedeutet.
Ebenso weisen Gesellschaftsphänomene wie ein vergleichsweise niedriger Wunsch nach Kindern, eine starke Tendenz zum Alleinleben oder zahlreiche emotionale Burnouts, Depressionen und soziale Isolation auf tiefsitzende Verarbeitungsprobleme hin. Einige Experten geben der Generation nach dem Krieg, die noch stark von Haarers Erziehungsgrundsätzen beeinflusst war, eine bedeutsame Rolle in dieser Entwicklung.Ein Beispiel aus der Forschung sind die sogenannten „Strange Situation“-Tests, mit denen die Bindungsqualität von Kleinkindern analysiert wird. Diese Untersuchungen zeigten, dass viele deutsche Kinder als besonders „unabhängig“ gelten – doch diese Unabhängigkeit beinhaltet oft, sich wenig verletzt oder ängstlich zu zeigen. Das kann ein Schutzmechanismus sein, der jedoch den Aufbau emotionaler Intimität erschwert.
Außerdem zeigen Beobachtungen, dass Mütter oftmals instinktiv darauf verzichten, auf das Weinen ihrer Kinder emotional zu reagieren, aus Angst, sie zu „verwöhnen“. Ein solcher Verzicht kann Entwicklungstraumata verursachen, die sich im späteren Erwachsenenalter in Beziehungsunfähigkeit und psychischen Leiden manifestieren.Interessant ist auch der intergenerationelle Aspekt: Menschen neigen dazu, die Erfahrungen und Verhaltensweisen ihrer Eltern unbewusst weiterzutragen. Rasche emotionale Rückfälle in stressigen Situationen zeugen von verinnerlichten Reaktionsmustern, die schwer zu ändern sind. Die Tochter Johanna Haarers, Gertrud, bezeichnete von sich aus, dass die belasteten Kindheitserfahrungen sie davon abhielten, selbst Mutter zu werden.
Ihre öffentliche Auseinandersetzung mit dem Erbe zeigt, wie tief und persönlich diese Themen oft verwurzelt sind.Die theoretische und empirische Forschung stützt die Vermutung, dass das Trauma von entfremdeter und harter Erziehung aus der NS-Zeit bis in die Gegenwart hinein wirkt. Es stellt eine wissenschaftlich fundierte Erklärung dafür dar, warum in Teilen der deutschen Bevölkerung emotionale Distanz und Bindungsschwierigkeiten verbreitet sind. Dennoch ist zu betonen, dass viele Familien alternative, liebevolle und gesunde Erziehungsmuster entwickelt haben, da die Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelte und moderne pädagogische Erkenntnisse Einzug hielten.Um die Folgen zu minimieren, setzen sich in Deutschland Fachleute aus Psychologie und Pädagogik dafür ein, das Bewusstsein für Bindungstheorien und emotionale Bedürfnisse von Kindern zu stärken.
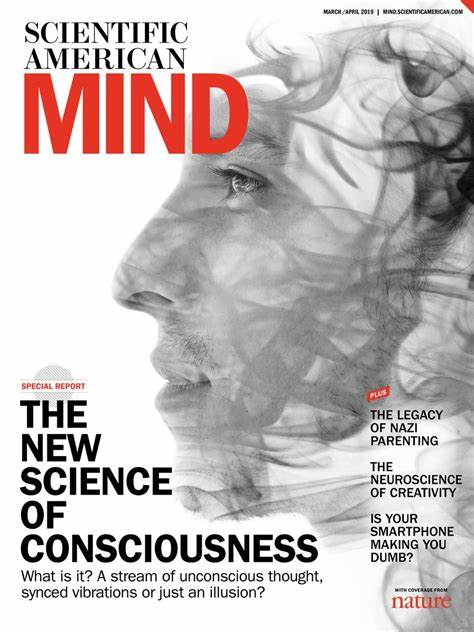




![Measurement Data (1996) [pdf]](/images/F7F053AE-4BCC-4012-9A42-8ABC37C8A8B4)



