In der Welt der eingebetteten Systeme ändern sich Technologien rasant, doch manche Geräte bleiben über Jahre hinweg unverändert im Einsatz und verlieren dabei zunehmend den Support der Hersteller. OpenWrt als schlanke, Linux-basierte Firmware bietet eine flexible Plattform, um diesem Problem entgegenzuwirken. Kombiniert man diese mit dem Raspberry Pi, insbesondere dem Modell 1 mit seinem ARMv6-Prozessor, ergeben sich spannende Möglichkeiten für Entwickler und Sicherheitsanalysten. Besonders interessant wird die Nutzung von Frida – einem modernen Werkzeug für dynamische Instrumentierung und Hacking – um funktionsübergreifende Analysen und Manipulationen auf dem System durchzuführen. OpenWrt und Raspberry Pi: Die perfekte Kombination für Hacking und Entwicklung OpenWrt ist eine freie, open-source Firmware, die ursprünglich für Netzwerkgeräte entwickelt wurde, sich aber mittlerweile auf unterschiedlichsten Hardwareplattformen etablieren konnte.
Der Raspberry Pi 1, mit seinem 700 MHz ARM1176JZF-S Kern, ist zwar mittlerweile veraltet, bietet aber genau die Art von Hardware, wie sie oft in älteren Netzwerkgeräten oder Industrieanlagen zu finden ist. Diese Plattform eignet sich somit hervorragend, um OpenWrt einzusetzen und durch eigene Tools wie Frida neue Einblicke in das Systemverhalten zu gewinnen. Ein wesentlicher Vorteil dieser Kombination ist, dass OpenWrt eine musl libc-basierte minimale Linux-Umgebung bietet und auf dem Pi gleichzeitig genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, um eine erweiterte Toolchain zu betreiben. Dies ermöglicht es, moderne Werkzeuge zu nutzen, die sonst auf solchen älteren Geräten nicht lauffähig wären. Die Herausforderung: Moderne Tools auf alten Systemen verwenden Viele Hersteller hören irgendwann auf, Software-Updates für ihre Geräte bereitzustellen, Sicherheitslücken bleiben unbehandelt.
Das erschwert das Verständnis, die Absicherung oder gar das Reverse Engineering solcher Systeme erheblich. Gleichzeitig sind viele „out-of-the-box“ verfügbare Debugging- oder Hacking-Werkzeuge nicht für die alten Architekturen oder das eingeschränkte Filesystem solcher Geräte geeignet. Dies gilt besonders für hochentwickelte Instrumentierungstools wie Frida, das zahlreiche Abhängigkeiten und moderne Bibliotheken voraussetzt. Sollten Sie versuchen, GDB, Python oder Frida direkt auf einem derart abgespeckten System zu installieren, stoßen Sie oft auf fehlende Bibliotheken, inkompatible Toolchains oder schlichtweg unzureichende Ressourcen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine angepasste, selbstgebaute Umgebung bereitzustellen, die ohne Einfluss auf das Basissystem funktioniert – sprich eine isolierte Entwicklungs- und Laufumgebung „auf der Seite“.
Der Weg zur eigenen Toolchain für Raspberry Pi 1 und OpenWrt Der erste Schritt in diesem Prozess ist das Erstellen eines Cross-Compilers, der auf Ihrem modernen Linux-System läuft, aber Binaries für den ARMv6-Architekturzweig des Raspberry Pi 1 erzeugt. Dabei ist es wichtig, eine Toolchain zu verwenden, die kompatibel mit der Musl libc Version von OpenWrt ist, in diesem Fall Version 1.1.16. Da neuere Versionen nicht binärkompatibel sind, muss hier besondere Sorgfalt walten.
Die hier empfohlene Toolchain nutzt GCC 14.2, die aktuellste stabilste Version, konfiguriert auf ARMv6kz und optimiert für den ARM1176JZF-S Kern inklusive Hardware-FPU-Unterstützung. Die basierend auf dem musl-cross-make Projekt generierte Toolchain ist einzigartig darin, modernste Compilerfunktionen mit alten Bibliotheksversionen zu vereinen. Dies erlaubt komplizierte Pakete wie Frida und Python 3.13 erfolgreich zu übersetzen.
Parallel dazu wird ein Mini-Root-Filesystem aufgebaut, welches neben dem Toolchain-Support alle notwendigen Bibliotheken, Tools und Abhängigkeiten enthält. Es wird in einem eigenen Verzeichnis unter /root/pack auf dem Zielgerät installiert und überschreibt nicht die vorhandene Umgebung. Durch ein Set von Build-Scripts und Makefiles lassen sich alle Komponenten automatisch herunterladen, übersetzen und zusammensetzen – inklusive Python 3.13 mit den benötigten Third-Party-Paketen. Frida auf OpenWrt: Instrumentierung ohne Grenzen Frida bietet eine mächtige Plattform, um Prozesse auf verschiedenen Systemen dynamisch zu instrumentieren, Datenflüsse zu analysieren oder Funktionen zu hooken und zu manipulieren – zur Laufzeit.
Die Komplexität des Paketes und seine zahlreichen Abhängigkeiten machten es bisher schwierig, es auf alten, wenig unterstützten Plattformen wie OpenWrt auf dem Raspberry Pi einzusetzen. Mit der eigens gebauten Toolchain und dem Mini-Root-Filesystem ist es nun möglich, Frida in seiner aktuellen Version 16.6.6 mit vollständiger Python 3.13 Unterstützung laufen zu lassen.
Wichtig ist dass Fridas native C-Runtime genutzt wird, um Kompatibilität zu gewährleisten. Das erlaubt flexibel erweiterbare Tracing-Skripte, automatische Hook-Generierung mit frida-trace und interaktive Sessions mittels frida-Python-API. Erstmals können Sicherheitsforscher damit auf einem historischen ARM-Prozessor moderne Hacking-Techniken einsetzen – was erheblich mehr Einblick in Prozesse und deren Verhalten erlaubt als klassische Debugger. Selbst komplexe Anwendungen wie der uHTTPd Webserver lassen sich instrumentieren, um genaue Funktionsaufrufe, Parameter und Daten zu beobachten und interaktiv zu verändern. Erweiterte Tools für eine verbesserte Nutzererfahrung Zusätzlich zu Frida selbst wurden im Rahmen des Projekts nützliche Hilfsprogramme wie der Bash-Shell-Ersatz, htop, nano und GDB mit kompakten Patches bereitgestellt.
Diese erweitern die Eingriffsmöglichkeiten auf dem Raspberry Pi mit OpenWrt enorm und bieten eine vertraute Umgebung zur Analyse und Ad-hoc-Bearbeitung der Systeme. Durch das gesamte Framework hindurch wird konsequent mit RPATH gearbeitet, sodass alle Bibliotheken lokal unter /root/pack/lib referenziert werden. Dies gewährleistet, dass ein Herunterziehen oder Verändern der Feed- oder Systembibliotheken entfällt und unnötige Wechselwirkungen mit dem Basissystem vermieden werden. Praxis: Aufbau und Einsatz auf dem Raspberry Pi 1 Die Installation beginnt mit dem Herunterladen und Flashen des passenden OpenWrt-Images für den Raspberry Pi 1. Aufgrund der kleinen Größe des Images ist es nach dem Flashen ratsam, die Partitionen mit Tools wie fdisk und resize2fs zu vergrößern, um den gesamten Speicherplatz der SD-Karte zu nutzen.
Anschließend wird die Netzwerkkonfiguration angepasst, um via DHCP den Zugriff per SSH zu ermöglichen. Darauf folgt das Übertragen und Auspacken der vorbereiteten Tarball-Pakete von Frida und seinen Abhängigkeiten in das Installationsverzeichnis /root/pack. Mit dem Start einer interaktiven Bash-Shell aus diesem Verzeichnis sowie der Anpassung des PATH können sämtliche Werkzeuge direkt verwendet werden. Ein praktisches Beispiel ist die Verwendung von frida-trace, um Funktionsaufrufe des Webservers uhttpd gezielt zu verfolgen. Wildcard-Optionen erlauben es, große Funktionsgruppen wie alle read- oder send-Funktionen zu überwachen und automatisch passende Hook-Handler zu erstellen.
Diese lassen sich im Anschluss mit Frida JavaScript API beliebig modifizieren und erweitern. Die Integration einer Web-UI ist zwar vorhanden, auf dem terminalbasierten Gerät jedoch eher von geringer Bedeutung. Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten zur Optimierung Die hier beschriebene Lösung ist bewusst nicht auf kleinstmöglichen Footprint getrimmt. Alle Bibliotheken, statische Dateien und Werkzeuge werden ohne rigorose Reduzierung ins System integriert. Damit bleiben noch umfangreiche Möglichkeiten offen, Speicher und Arbeitsspeicher zu optimieren, um beispielsweise Portierungen auf noch ältere oder ressourcenärmere ARM-Architekturen zu ermöglichen.
Auch der Einsatz auf völlig anderen Embedded-Plattformen wäre denkbar. Anpassungen der Toolchain für Architekturen wie ARMv4T oder ARMv5TE (verbreitet in älteren ARM9-basierten Systemen) könnten weitere Türen öffnen. Wenngleich hier der begrenzte RAM eine Herausforderung darstellt, helfen hier gezielte Kompilier- und Linkereinstellungen sowie das Entfernen unnötiger Komponenten. Darüber hinaus bieten die Möglichkeiten moderner Hacking- und Reversing-Tools wie Frida zahlreiche spannende Ansatzpunkte für Forschungen, von Traffic-Analyse bis Speicher-Manipulation und Echtzeit-Debugging selbst auf veralteter Hardware. Fazit Die Kombination von OpenWrt auf dem Raspberry Pi 1 mit einer maßgeschneiderten Toolchain erlaubt die Nutzung moderner Instrumentierungs- und Debugging-Tools wie Frida auf einem historisch bedeutsamen Embedded-System.
Dies öffnet neue Wege für Security Research, Softwareanalyse und Reverse Engineering, gerade bei Geräten, die seit langer Zeit keinen Hersteller-Support mehr erhalten. Der vorgestellte Ansatz zeigt, wie sich mit gezieltem Cross-Compiling, isolierten Mini-Root-Filesystemen und sorgfältiger Anpassung Software wie Python 3.13 und Frida auf umgebungsspezifische Herausforderungen optimieren lassen. Das Resultat ist eine leistungsfähige, dennoch kompakte Entwicklungsumgebung, die selbst auf limitiert ausgestatteten Appliances eine frische Brise an Hacker-Kreativität entfacht. Für Entwickler und Forscher bietet sich somit eine praktische Basis, um alte Geräte neu zu entdecken, Schwachstellen aufzuspüren und eigene Werkzeuge auf einer preiswerten, austauschbaren Plattform zu etablieren – frei von Einschränkungen durch veraltete Hersteller-Images.
Ebenso lädt das Projekt zum Mitgestalten ein, indem beispielsweise Architekturen oder Tool-Ketten an weitere historische Systeme angepasst werden können. So bleibt der Raspberry Pi 1, jahrzehntelang bewährter ARM-Pionier, weiterhin ein wertvolles Testbett moderner Cybersecurity-Techniken, mit OpenWrt und Frida als kraftvollen Helfern an seiner Seite.
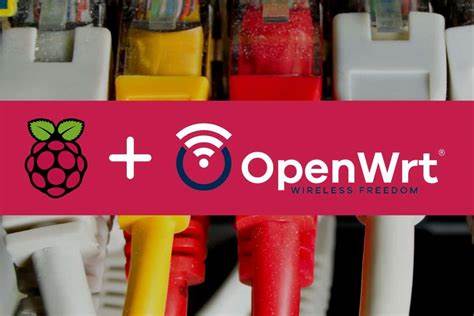


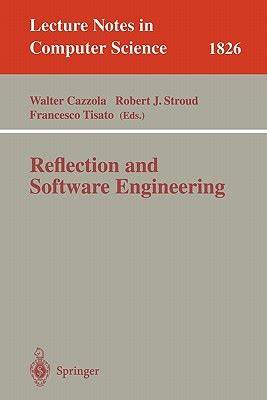
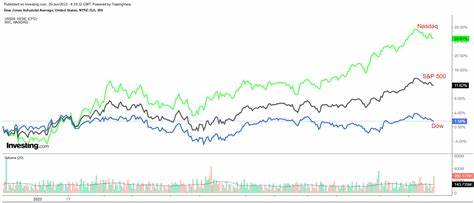
![One of the Fastest Supercomputers [video]](/images/663D9A0D-03B0-4265-A11D-506DD7E5E4D2)
![Eliminating Entire Classes of Memory Safety Vulnerabilities in C and C++ [video]](/images/E4ED7611-80B1-471B-9DB5-6BCFD2863319)
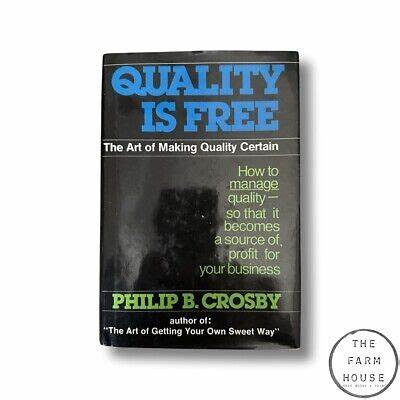
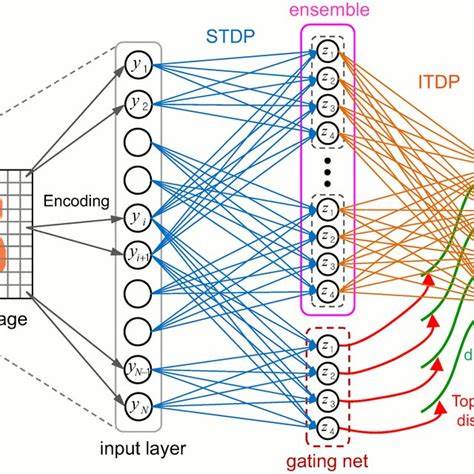
![Python: The Documentary [Official trailer] [video]](/images/FF2A7C41-4A65-4355-880E-3B10BD295570)