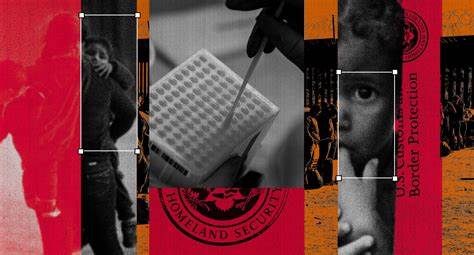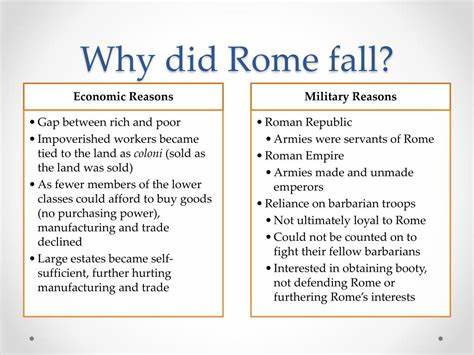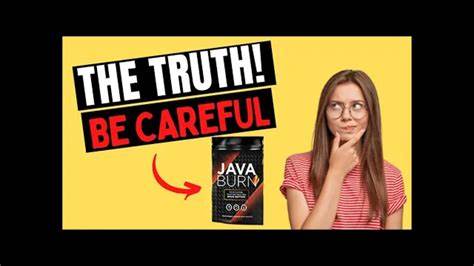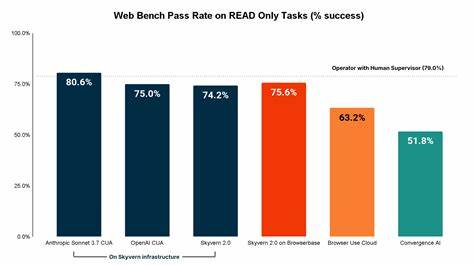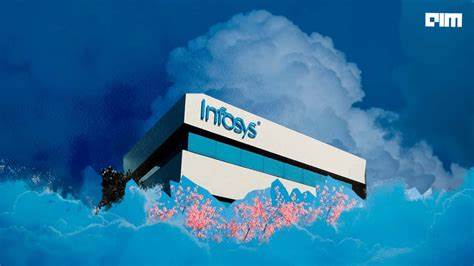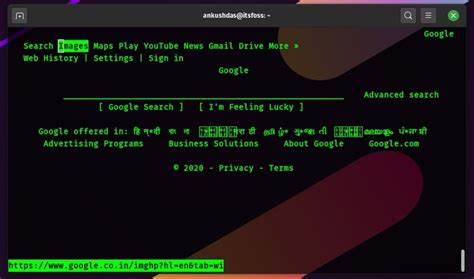In den letzten Jahren hat die Diskussion um die Erfassung biometrischer Daten an den US-Grenzen deutlich an Brisanz gewonnen. Aufsehen erregt vor allem die Tatsache, dass DNA-Proben von tausenden migrantischen Kindern bereits ab einem Alter von vier Jahren von US-Grenzschutzbehörden (Customs and Border Protection, CBP) entnommen und in einer nationalen Strafdatenbank hinterlegt werden. Diese Entwicklung stellt eine deutliche Erweiterung der biometrischen Überwachung an der Grenze dar, die nicht nur kritische rechtliche Fragen aufwirft, sondern auch ethische und gesellschaftliche Bedenken hervorruft. Die DNA von über 133.000 Minderjährigen wurde im Rahmen dieses Programms gesammelt und in das vom FBI betriebene Combined DNA Index System, kurz CODIS, eingespeist, das eigentlich zur Identifizierung von Kriminellen und Straftätern entwickelt wurde.
Die Dokumente, die auf Basis von Anfragen nach dem Freedom of Information Act veröffentlicht wurden, offenbaren erstmals den Umfang und die Tiefe, mit der die US-Regierung biometrische Daten junger Migranten sammelt und speichert. Dabei handelt es sich häufig um Kinder und Jugendliche, die sich in einer besonders verletzlichen Situation befinden – viele von ihnen haben keinerlei Verbindung zu kriminellen Handlungen, sind jedoch dennoch Teil eines Systems, das genetische Daten in einem kriminologischen Zusammenhang katalogisiert. Die Erfassung der DNA erfolgt in der Regel mittels eines Bürstenabstrichs aus der Mundhöhle. Mit diesem relativ einfachen Verfahren wird die gesamte genetische Information eines Menschen erfasst. Während für die Speicherung in CODIS lediglich eine reduzierte genetische Signatur – sogenannte genetische Marker zur Identifikation – genutzt wird, bleibt das rohe genetische Material potentiell unbegrenzt gespeichert und birgt somit ein hohes Risiko für zukünftigen Missbrauch.
Kritiker warnen daher vor einer dauerhaften und unkontrollierten genetischen Überwachung, die weit über die ursprünglichen Zwecke eines kriminaltechnischen Einsatzes hinausgeht. Die US-Regierung begründet die Praxis mit dem Argument, durch die DNA-Sammlung potenzielle Gefahren für die öffentliche Sicherheit frühzeitig zu erkennen. Laut dem Justizministerium trägt dieses Verfahren dazu bei, Straftaten aufzuklären – sowohl solche, die in der Vergangenheit begangen wurden, als auch Verbrechen, die in der Zukunft möglicherweise entstehen könnten. Doch diese Rechtfertigung wird von Datenschützern und Wissenschaftlern scharf kritisiert, denn bei vielen der Betroffenen handelt es sich um schutzbedürftige Minderjährige, die erst am Beginn eines unsicheren Lebenswegs in die Vereinigten Staaten stehen. Insbesondere die Tatsache, dass DNA von Kindern unter 14 Jahren, die nach offiziellen Richtlinien eigentlich von solchen Maßnahmen ausgenommen sein sollten, gesammelt wird, führt zu Empörung.
Laut den veröffentlichten Daten gab es Fälle, in denen Kinder ab vier Jahren DNA-Proben entnommen wurden, oft ohne dass in den Akten eine kriminelle Verwicklung dokumentiert wurde. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zu den momentanen Altersgrenzen für Fingerabdrücke und biometrische Erfassungen, die erst ab 14 Jahren routinemäßig angewandt werden sollen. Die Entscheidung, DNA von jüngeren Kindern zu speichern, liegt im Ermessen der Einsatzkräfte, was zu einer intransparenten und teils willkürlichen Praxis führt. Außerdem befanden sich unter den DNA-Profilen auch rund 122 Minderjährige, die als US-amerikanische Staatsbürger geführt werden. Darunter waren mindestens 53 Kinder, die sich nicht im Zusammenhang mit strafrechtlichen Untersuchungen oder Verhaftungen in Gewahrsam befanden.
Diese Umstände werfen erhebliche Fragen bezüglich der Rechtmäßigkeit und der Einhaltung der Menschenrechte auf, da für gewöhnlich auch Asylsuchende, die sich im zivilrechtlichen Verfahren befinden, von dieser Praxis betroffen sind. Die Rolle von CBP ist dabei bedeutsam, da diese Behörde die erste Instanz bei der Erfassung und Behandlung von Migranten an der Grenze darstellt. CBP-Mitarbeiter nehmen Fingerabdrücke und DNA-Proben, oft bereits bei der ersten Festnahme oder Sicherstellung, bevor eine weiterführende Strafverfolgung oder Einwanderungsverfahren eingeleitet werden. Zwar übernimmt das US-Einwanderungs- und Zollvollzugsdienstes ICE die weitergehende Kontrolle und Verarbeitung von Migranten, doch die biometrischen Daten verbleiben in Langzeitdatenbanken, die zu Strafzwecken genutzt werden können. Der Zugang zu solchen Datenbanken ermöglicht es Strafverfolgungsbehörden auf allen Ebenen – lokal, bundesstaatlich und national – DNA von Tatorten mit der gespeicherten Datenbank abzugleichen.
CODIS wurde ursprünglich konzipiert, um besonders schwere Straftaten wie Sexualdelikte oder Gewaltverbrechen zu verfolgen und unaufgeklärte Fälle durch Datenabgleiche zu lösen. Die Einbindung der DNA von Menschen ohne kriminelle Vergangenheit wirft jedoch ein fundamentales Problem auf: Es entsteht ein genetisches Profil, das diese Menschen dauerhaft und ohne nachweisbaren Grund mit dem kriminellen Überwachungssystem verknüpft. Fachleute und Menschenrechtsorganisationen beschreiben den Vorgang als dystopisch und warnen vor einer Ausweitung der genetischen Kontrolle, die weit über die eigentliche Intention der Strafverfolgung hinausgehen könnte. Es bestehen Bedenken, dass die gespeicherten Rohdaten der DNA künftig für weitere Zwecke genutzt werden könnten, etwa zur genetischen Profilbildung, zur Vorhersage von genetischen Erkrankungen oder sogar zur Verknüpfung von Familienstammbäumen – insbesondere in einem Migrationskontext, der ohnehin mit Ängsten und Vorurteilen aufgeladen ist. Zudem gibt es keine klaren oder transparenten Regeln, wie lange diese Daten gespeichert werden und welche Schutzmechanismen gegen Missbrauch existieren.
Das Justizministerium erklärte lediglich, dass sie die Speicherung der Roh-DNA für einen fairen Prozess benötigen, um bei einem Treffer die Stichhaltigkeit der Übereinstimmung bestätigen zu können. Allerdings wurde nicht eindeutig beantwortet, wie lange die genetischen Proben aufbewahrt werden – was Datenschützer als ungemein riskant einstufen. Aktuelle Studien zeigen zudem, dass es keinerlei belegbaren Zusammenhang zwischen Einwanderung und einer Zunahme von Kriminalität gibt. Die Praxis, biometrische Daten schon bei Minderjährigen routinemäßig zu erfassen und in ein Strafregister aufzunehmen, scheint demnach vor allem eine präventive Überwachungsmaßnahme zu sein, die auf Annahmen zukünftiger Straftaten beruht. Eine solche Annahme widerspricht grundlegenden Prinzipien von Unschuldsvermutung und Datenschutz.
Die verstärkte DNA-Erfassung an den US-Grenzen hat sich insbesondere seit 2020 ausgeweitet, nachdem Änderungen in den Richtlinien es ermöglichten, auch Personen in ziviler Haft zu erfassen, die zuvor davon ausgenommen waren. Die Daten zeigen, dass unter der aktuellen Regierung der Biden-Administration die Entnahme von DNA-Proben noch weiter zunahm, parallel zum Anstieg der Grenzübertritte. Beispielhaft sind Meldungen von Standorten wie Laredo, Texas, an denen an einem einzigen Tag Tausende von Proben aufgenommen wurden, darunter Hunderte von Minderjährigen. Kritiker bezeichnen dieses Vorgehen als genetische Massenüberwachung, die von der ursprünglichen Aufgabe der Grenzbehörden weit entfernt sei. Sie fordern eine sofortige Überprüfung der Praktiken, klare gesetzliche Regelungen und eine strikte Beschränkung der Erfassung und Speicherung von biometrischen Daten.
Statt Kinder und Jugendliche vorsorglich in ein Strafsystem aufzunehmen, müsse der Fokus auf den Schutz ihrer Rechte und ihrer Unschuldsvermutung liegen. Der Fall zeigt exemplarisch, wie technologische Fortschritte im Bereich der Biometrics und Genomik in Verbindung mit politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen genutzt werden können, um Überwachungsstrukturen auszubauen. Dabei werden ethische Grenzen häufig überschritten, ohne dass den Betroffenen ausreichend Informationen oder Schutz gewährleistet werden. Nicht zuletzt führt die Speicherung der DNA von Minderjährigen in kriminellen Datenbanken zu einem Spannungsfeld zwischen Sicherheitspolitik und Grundrechten. Während die Regierung die Methode als unverzichtbares Werkzeug zur Verbrechensbekämpfung und Gefahrenabwehr darstellt, betonen Datenschützer, Rechtsexperten und Menschenrechtsorganisationen, dass die Praxis einer demokratischen Kontrolle entzogen ist und gravierende Folgen für die Privatsphäre, die persönliche Freiheit und das gesellschaftliche Vertrauen in staatliche Institutionen haben kann.
Zusammenfassend verdeutlicht die Sammlung und Lagerung der DNA von migrantischen Kindern in den USA ein komplexes Dilemma an der Schnittstelle von Technologie, Recht und Ethik. Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist deshalb von zentraler Bedeutung, um sicherzustellen, dass biometrische Mittel nicht zu Instrumenten weitreichender Überwachung und Ausgrenzung werden, sondern im Einklang mit Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit genutzt werden.