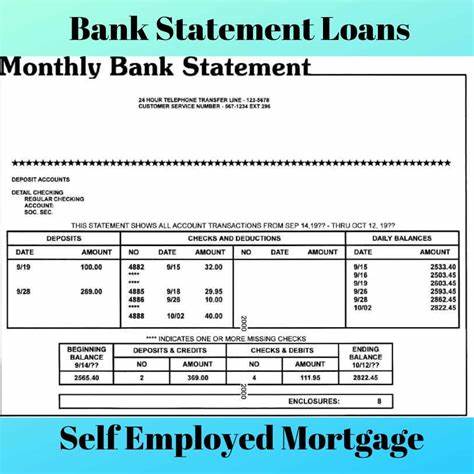In den letzten Jahren rücken verlassene Bergwerke und ihre potenziellen Gefahren immer stärker in den Fokus von Stadtplanern, Behörden und Bewohnern. Immer wieder werden Phänomene wie plötzlich auftretende Senkungen oder massive Sinklöcher beobachtet, die Straßen, landwirtschaftliche Flächen und sogar Siedlungen beeinträchtigen oder zerstören können. Ein besonders gravierendes Beispiel hierfür lässt sich an der Interstate 80 nahe Wharton, New Jersey, beobachten, wo zwischen Dezember 2024 und dem Frühjahr 2025 mehrere große Sinkholes entstanden sind, teils in unmittelbarer Nähe stark frequentierter Verkehrswege. Diese Vorfälle sind kein natürliches Gegebenheit, sondern die Folge historischer industrieller Aktivitäten, die tief unter der Erde ihre Spuren hinterlassen haben: das Verlassen von unterirdischen Bergwerken, vor allem solchen, die vor mehr als hundert Jahren angelegt wurden. Die Thematik ist komplex und weltumspannend, da unzählige Regionen vom Bergbau geprägt wurden und vielfach alte Schächte unzureichend dokumentiert oder gar vergessen wurden.
Die Geschichte des Bergbaus ist eng mit der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft verbunden. Ursprünglich begann alles mit dem Abbau oberflächennaher Rohstoffe, die für Werkzeuge, Werkstoffe und Brennstoffe genutzt wurden. Mit dem Fortschreiten der Technik und durch den steigenden Bedarf verlagerten sich die Abbauarbeiten zunehmend in die Tiefe. Um wertvolle Mineralien, Kohle oder Eisenerz in profitabler Menge fördern zu können, mussten Stollen und Schächte in komplizierten Systemen erstellt werden. Dabei spielte das sogenannte „Room and Pillar“-Verfahren eine zentrale Rolle.
Bei dieser Methode werden Bergwerksräume ausgehöhlt während gleichzeitig Pfeiler aus Massivmaterial stehenbleiben, die das überlagernde Gestein stützen sollen. Es war eine Abwägung zwischen maximalem Rohstoffabbau und der Sicherheit der Stollen – und in der Praxis tendierten viele Unternehmen dazu, die Pfeiler so klein wie nur möglich zu halten, um den Ertrag zu maximieren. Die Herausforderung dabei ist, dass nach dem Verlassen der Bergwerke oftmals keine Maßnahmen getroffen wurden, um die dauerhafte Stabilität der unterirdischen Hohlräume zu gewährleisten. Im Gegenteil: Viele alte Minen wurden ohne detaillierte Dokumentation und oft von Firmen betrieben, die später verschwanden oder Insolvenz anmeldeten. Durch fehlende Nachsorge, Pumpen stopp, das Eindringen von Wasser und die natürlichen Prozesse des Gesteins und Bodens beginnen die Stützen zu erodieren, zu zerfallen und irgendwann nachzugeben.
Der Boden darüber reagiert durch Setzungen und bricht im schlimmsten Fall ein. Dann entstehen plötzliche Sinklöcher, die Bauwerke zerstören, Straßen unpassierbar machen oder gar Menschenleben gefährden können. Es gibt verschiedene Formen von Subsidenz, also jenem Phänomen, bei dem sich der Boden absenkt. Zum einen treten punktuelle Senkungen auf, die oft als diskrete Sinkholes sichtbar werden. Diese lösen sich meist plötzlich und können dort Schäden verursachen, wo man es kaum erwartet.
Zum anderen gibt es eine eher gleitende, flächige Senkung, die über eine größere Fläche hinweg auftritt und nicht immer sofort erkannt wird. Gerade wenn Bergwerke tief liegen, kann die Erdoberfläche sich zwar weiter absenken, der Prozess ist jedoch schleichend und manifestiert sich weniger dramatisch. Dennoch bleibt dieser Prozess gefährlich, da er Gebäude deformiert, Rohrleitungen bricht und Landschaften langfristig verändert. Diese flächigen Senkungen führen nicht selten zu teuren Sanierungen und komplexen Planungsproblemen für Gemeinden. Eine entscheidende Rolle spielt Wasser.
Historisch pumpten Bergwerke das Wasser aus den Stollen, damit der Abbau trocken verlief. Nach der Betriebsaufgabe blieb dieses Pumpen häufig aus, so dass sich die Hohlräume langsam mit Wasser füllten. Wasser in Verbindung mit gelösten Mineralien wie Gips oder Kalkstein führt dazu, dass sich Stützstrukturen auflösen oder schwächen. Zudem kann Wasser den Boden aufweichen, seine Tragfähigkeit verringern und Beschleuniger für bodenmechanische Prozesse werden. In vielen Modellvorführungen, etwa die Visualisierung von Grady in seinem inoffiziellen Bergwerksmodell, sieht man, wie wiederholtes Nass- und Trockenwerden sowie kleine Risse langfristig zur Instabilität beitragen.
Hinzu kommt, dass die Eigentumsverhältnisse unter der Erde oft kompliziert sind. In vielen Fällen liegen Eigentumsrechte für die Oberfläche und das Bodenschatzrecht bei verschiedenen Parteien. Das macht eine Koordination schwieriger, sowohl bei der Informationsbeschaffung als auch bei der Haftung für Folgeschäden. Für betroffene Grundstückseigentümer ist dies ein großes Problem. Denn wenn das Haus plötzlich durch eine Setzung beschädigt wird, springt die reguläre Hausversicherung meist nicht ein, da Bergbauschäden ausdrücklich ausgeschlossen sind.
In einigen Bundesstaaten der USA gibt es deshalb spezielle Versicherungsprogramme, die durch einen Pool von Mitteln aus Steuern oder Abgaben der Bergbauindustrie finanziert werden, um wenigstens eine Grundabsicherung zu gewährleisten. Moderne Bergbaumethoden haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und setzen auf effiziente und kontrollierbare Verfahren. Das Longwall-Mining etwa ist ein Verfahren, bei dem große Flächen der Kohle abgebaut werden, unterstützt durch hydraulische Stempel, die die Deckschicht auffangen. Die Technik erlaubt zwar die vollständige Ausbeute der Kohle, führt aber unweigerlich zu einem beabsichtigten und gesteuerten Einsturz des Hohlraums hinter der Abbaustrecke. Das bedeutet, dass die Oberfläche absichtlich nachgibt, allerdings auf kontrollierte und möglichst planbare Weise.
Dies reduziert unvorhergesehene Schäden und ermöglicht zumindest eine bessere Prognose und passende Vorsorgemaßnahmen. In Ländern mit jahrhundertelanger Bergbautradition sind unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen worden, die den Umgang mit alten Bergwerken regeln. Dazu gehören Nachforschungen zur Lage und Zustand alter Gruben, freiwillige wie verpflichtende Sanierungen und die Einrichtung von Fonds für Bergbauschäden. Dennoch bleibt das Risiko groß, weil viele bergbauliche Tätigkeiten vor Zeiten der strengen Regulierung und Dokumentation stattfanden. Neben der rechtlichen Seite stehen Ingenieure und Geotechniker vor der technischen Herausforderung, Bergbaufolgeschäden präzise vorherzusagen und zu überwachen.
Die Komplexität ergibt sich aus der Variabilität der geologischen Bedingungen, der Eigentumsverhältnisse, der Wasserbewegungen und dem langfristigen Verhalten von Gestein und Boden. Es werden verschiedenste Instrumente eingesetzt, wie Inklinometer und Extensometer, um bodenbewegungen zu messen. Hinzu kommen numerische Simulationsverfahren, die mit geotechnischen Daten, historischen Informationen und realen Messwerten gespeist werden, um robuste Modelle zu erstellen. Dennoch bleibt es ein Auf und Ab – kleine Veränderungen unter der Oberfläche führen nicht immer unmittelbar zu sichtbaren Schäden, bis sich irgendwann ein kritischer Punkt nähert. Die Sanierung von einsturzgefährdeten Bereichen und die Minderung der Risiken stellen unterschiedlichste Anforderungen an Fachleute.
Je nach Situation kann es genügen, sinkende Flächen aufzufüllen und dauerhaft zu stabilisieren, oder es müssen aufwendige bauliche Maßnahmen ergriffen werden. Besonders bei akuten Senkungen wie plötzlichen Sinkholes ist schnelles Handeln wichtig, um Menschen und Infrastruktur zu schützen. Innovative Methoden zur Stabilisierung umfassen das Verpressen von Hohlräumen mit speziellen Materialien wie Zement, Harz oder Schaum, um die Tragfähigkeit wiederherzustellen und weiteren Absenkungen vorzubeugen. Die fortschreitende Urbanisierung macht das Thema Bergbaufolgeschäden insgesamt relevanter. Früher lagen viele Bergbauanlagen in ländlichen, wenig besiedelten Gebieten.
Heute sind in vielen Regionen Siedlungen und Verkehrsflächen genau dort entstanden, wo früher Bergwerke standen. Dadurch wächst der Bedarf an Kenntnis, Überwachung und Schutzmaßnahmen. Öffentlichkeitsarbeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, denn viele Bürger kennen die Geschichte ihrer Region nicht und verstehen die Gefährdung nicht sofort. Informationskampagnen und transparente Kommunikation sind essenziell, damit Eigentümer und Nutzer der Flächen angemessen informiert sind und entsprechend handeln können. Letztlich ist der Umgang mit verlassenen Bergwerken ein Spiegelbild des Fortschritts in Technik, Umweltbewusstsein und Gesetzgebung.
Früher wurden kurzfristige Profite bevorzugt, langfristige Folgen ignoriert. Heute stehen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Vorsorge im Vordergrund. Trotzdem bleibt die Altlast vergangener Zeiten eine Herausforderung, die nicht ohne Aufwand und interdisziplinäre Zusammenarbeit bewältigt werden kann. Bergbau ist und bleibt ein wichtiger Wirtschaftszweig, der Ressourcen liefert, auf die wir angewiesen sind. Gleichzeitig verlangt er Respekt vor der Natur und Weitsicht im Umgang mit den Folgen.