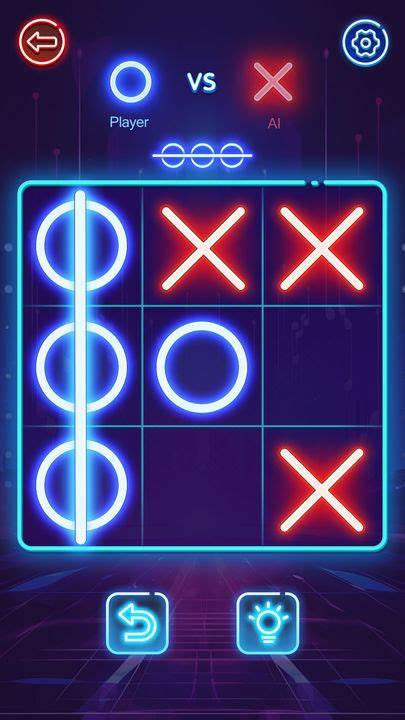Seit Jahrzehnten ist „googeln“ der Inbegriff für die Internetrecherche. Das Verb hat sich längst in den alltäglichen Sprachgebrauch integriert und steht für das schnelle Auffinden von Informationen über die weltgrößte Suchmaschine. Doch mit dem rapiden Aufstieg großer Sprachmodelle, auch LLMs (Large Language Models) genannt, wie ChatGPT, stellt sich die Frage, ob diese innovativen KI-basierten Technologien langfristig Googles Position als Ausgangspunkt für die Suche im Netz herausfordern oder gar ablösen können. Die Diskussion darum geht weit über den technologischen Fortschritt hinaus – sie tangiert die Art und Weise, wie Menschen künftig Informationen suchen, erhalten und verarbeiten werden. Die Entwicklung der Sprachmodelle ist bemerkenswert schnell verlaufen.
In nur wenigen Jahren haben Tools wie ChatGPT, Gemini oder Claude die Art verändert, wie wir mit digitalen Informationen interagieren. Anders als klassische Suchmaschinen liefern sie nicht nur Links zu Webseiten, sondern direkte Antworten in natürlicher Sprache sowie kontextgerechte Erklärungen. Dies unterscheidet sie in ihrer Funktion grundlegend von Suchmaschinen, die primär als Vermittler zwischen Anwender und relevanten Webinhalten fungieren. Die Praxis bestätigt, dass diese KI-Modelle immer häufiger als erste Anlaufstelle verwendet werden, um komplexe Fragestellungen in verständlicher Form zu beantworten, Recherchen zu starten oder kreative Aufgaben zu unterstützen. Trotz dieser Fortschritte bleibt die Frage komplex, ob sich daraus ein neues Verb etablieren kann, das eine derart gesellschaftlich verankerte Bedeutung wie „googeln“ erreichen wird.
Ein Verb entsteht nicht allein durch technische Innovation, sondern benötigt eine breite kulturelle Akzeptanz und Alltagsrelevanz. Google profitiert hier von einem frühen Marktvorsprung, einer intuitive Verbindung von Suchfunktion und Unternehmensname sowie der starken Verbreitung als erste Adresse für jegliche Internetrecherchen. In der Online-Community und unter Experten kursieren diverse Vorschläge für potenzielle neue Verben, die mit der Nutzung von LLMs verknüpft werden könnten. So tauchen kreative Konstrukte auf wie „ChatGPTen“, „Geminien“ oder „Llamafizieren“, mit Anspielungen auf bestimmte KI-Systeme. Diese Versuche bleiben häufig spielerisch und ambitioniert, stoßen jedoch bisher nicht auf breite Akzeptanz.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist die Verwendung von „grok“, ein Begriff aus der Science-Fiction, der tiefes Verständnis beschreibt und von manchen als passendes Verb vorgeschlagen wird, das den Umgang mit KI-gestützten Antworten besonders gut beschreibt. Dennoch bestätigt sich, dass die sprachliche Verankerung solcher Worte einen langen Prozess benötigt und nur einige wenige den Sprung in den allgemeinen Gebrauch schaffen. Eine bedeutende Rolle spielt auch die Form der Kommunikation. Nutzer beschreiben die Interaktion mit LLMs oftmals nicht als bloße Suchabfrage, sondern eher als Unterredung oder dialogische Wissensvermittlung. Das veränderte Nutzererlebnis beinhaltet einen personalisierten Austausch, der sich vom klassischen Suchmaschinenmodell unterscheidet.
Dies könnte dazu führen, dass das „Verbifizieren“ der Nutzung von LLMs sich in anderen sprachlichen Ausdrücken manifestiert, vielleicht alters- oder gruppenspezifisch unterschiedlich, anstelle eines universellen neuen Verbs. Neben sprachlichen Überlegungen gibt es technische und praktische Gründe, warum LLMs kurzfristig Google nicht als Leitbegriff der Suche ablösen dürften. LLMs verfügen zwar über beeindruckende Sprachverarbeitungsfähigkeiten, jedoch sind sie noch nicht perfekt, wenn es um die Aktualität und Verlässlichkeit der Informationen geht. Suchmaschinen bieten strukturierte Suchergebnisse, direkten Zugriff auf eine Vielzahl von Quellen und eine Gewissheit, dass Nutzer die Originalinformationen selbst überprüfen können. LLMs hingegen generieren Antworten basierend auf Trainingsdaten und Algorithmen, was gelegentlich zu Ungenauigkeiten oder Fehlern führen kann, insbesondere bei faktisch anspruchsvollen Anfragen.
Diese Einschränkungen geben Suchmaschinen weiterhin einen Vertrauensvorsprung in gewissen Nutzungskontexten. Auch das Nutzungsverhalten reflektiert diese Unterschiede. Ein persönliches Zeitprotokoll zeigt beispielsweise, dass manche Anwender trotz der Beliebtheit von KI-Tools weiterhin mehr Zeit mit klassischen Suchmaschinen verbringen oder diese parallel nutzen. Nutzer schätzen die verschiedenartigen Vorteile und ergänzenden Funktionen beider Systeme. Während LLMs mit Antworten in natürlicher Sprache und Synthese von Informationen punkten, bieten Google & Co.
große Transparenz und Vielfalt der Quellen. Damit ist eher ein Nebeneinander oder eine kooperative Nutzung der Technologien wahrscheinlich als eine vollständige Substitution. Nicht zuletzt bestimmen gesellschaftliche und wirtschaftliche Faktoren den Verlauf der Entwicklung. Googles Stellung als Suchmonopolist ist ausgesprochen stabil, unterstützt durch enorme Investitionen, kontinuierliche Innovation und eine gewachsene Infrastruktur. Die Integration von KI-Technologien in bestehende Suchsysteme ist ohnehin Teil der strategischen Ausrichtung vieler Suchmaschinenanbieter.
Es ist denkbar, dass in Zukunft hybride Lösungen entstehen, die Vorteile von LLMs und klassischen Suchalgorithmen vereinen. Die sprachliche Identität des Begriffs „googeln“ wird somit weiterhin präsent bleiben, auch wenn sich die Art der Suche wandelt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass große Sprachmodelle auf dem besten Weg sind, die digitale Recherche grundlegend zu bereichern und zu ergänzen. Dennoch ist eine Ablösung der Suchmaschine Google als Namensgeber für die Internetsuche als Verb zumindest kurzfristig unwahrscheinlich. Die komplexen Anforderungen an Sprachkultur, technische Zuverlässigkeit und Nutzungsgewohnheiten verleihen Google eine weiterhin zentrale Rolle.
Im Laufe der Zeit könnten neue Verben im Zusammenhang mit KI-Systemen entstehen, die eigenständige Bedeutungsfelder besetzen und vielleicht in bestimmten Nutzergruppen gebräuchlich werden. Die Suche im Internet wird sich unweigerlich verändern – ob dies jedoch in einem neuen Begiff wie „ChatGPTen“ oder in neuen sprachlichen Formen mündet, bleibt offen. Klar ist nur, dass der Begriff „googeln“ wohl noch eine Weile das Standardwerkzeug der Sprachkultur rund um Online-Recherche bleiben wird.