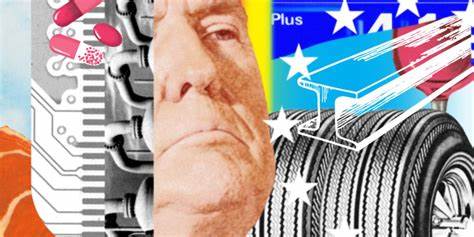In der heutigen Zeit, in der künstliche Intelligenz und computergestützte Systeme immer präsenter werden, stellt sich zunehmend die Frage, ob wir natürliche Agentur und Kognition tatsächlich vollständig durch Berechnung und algorithmische Prozesse erklären können. Eine neue Sichtweise, die sich aus den jüngsten Entwicklungen in den Bereichen Philosophie, Biologie und Kognitionswissenschaft ergibt, besagt, dass Agentur – also die Fähigkeit eines Lebewesens, aus eigenem Antrieb zu handeln – und Kognition – also die Art und Weise, wie Lebewesen Wissen erwerben und verarbeiten – grundlegend nicht rein computergestützt sind. Diese Erkenntnis hat weitreichende Konsequenzen für die Wissenschaft und Technologie, insbesondere für die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und unseres Verständnisses von Bewusstsein und Leben selbst. Der Begriff der Agentur beschreibt in seinem Kern die Fähigkeit einer Entität, auf Grundlage eigener intrinsischer Ziele und Normen aktiv zu handeln. Diese Fähigkeit ist eng mit dem Konzept der Autonomie verknüpft: ein lebendiges System agiert nicht bloß als simple Reaktion auf Reize, sondern verfolgt Ziele, die aus seiner eigenen inneren Organisation hervorgehen.
Kognition wiederum ist der Prozess, durch den solche Systeme ihre Umwelt wahrnehmen, Informationen verarbeiten und darauf basierend Entscheidungen treffen. Beide Prozesse sind demnach tief mit der Art und Weise verbunden, wie Organismen Sinn und Relevanz in einer komplexen Umwelt erkennen. Während in der traditionellen Sichtweise der Computationalismus vorherrscht, der davon ausgeht, dass mentale Prozesse nichts anderes als Berechnungen sind, die symbolische Informationen nach formalen Regeln verarbeiten, zeigt der aktuelle Forschungsstand erhebliche Limitationen dieses Ansatzes auf. Computermodelle arbeiten innerhalb „kleiner Welten“, das heißt vorab definierter, gut formulierter Problemstellungen mit klaren Regeln und Endpunkten. Im Gegensatz dazu existieren lebendige Organismen in „großen Welten“, deren Umgebungen durch Unbestimmtheit, Mehrdeutigkeiten und eine Fülle unvorhergesehener Ereignisse gekennzeichnet sind.
Für diese Arten von Problemen und Entscheidungssituationen reichen starr vorgegebene Algorithmen nicht aus. Ein zentrales Konzept, das in diesem Zusammenhang ins Zentrum der Debatte rückt, ist die sogenannte „Relevanzrealisierung“. Diese beschreibt die Fähigkeit eines Organismus, aus der komplexen und oft unübersichtlichen Information seiner Umwelt genau das herauszufiltern, was für sein Überleben, seine Anpassung und sein Handeln wirklich entscheidend ist – also die relevante Information zu erkennen. Diese Fähigkeit geht jedoch weit über das hinaus, was algorithmisch präzise definiert und formalisiert werden kann. Es handelt sich vielmehr um einen dynamischen, sich selbst organisierenden Prozess, der sich in einem ständigen Ausbalancieren von konkurrierenden Handlungsstrategien äußert und dessen Ausgang nicht vollständig vorhersehbar ist.
Biologische Systeme, insbesondere lebende Zellen und Organismen, besitzen eine einzigartige Organisationsform, die als autopoietisch oder selbstherstellend beschrieben wird. Diese Organisation ermöglicht es ihnen, sich selbst zu erhalten, zu reparieren und anzupassen, wobei sie intern einen Kreislauf von kausalen Beziehungen etablieren, der letztlich auf ihre eigene Selbsterhaltung ausgerichtet ist. Diese Form von Selbstorganisation unterscheidet sie grundlegend von mechanischen Systemen und Maschinen, deren Handlungen und Ziele von außen definiert werden. Ein Organismus verfolgt seine Ziele intrinsisch, was bedeutet, dass seine Agieren einer finalen Ursache folgt, die in seiner selbstbezogenen Organisation liegt. Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Fähigkeit von Lebewesen zur biologischen Antizipation.
Schon einfachste Organismen verfügen über Mechanismen, mit denen sie Erwartungshaltungen über zukünftige Zustände ihrer Umwelt entwickeln und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Das heißt, sie sind nicht nur reaktiv, sondern können potenzielle Konsequenzen ihres Handelns vorwegnehmen und daraus Schlüsse ziehen – ohne dafür notwendigerweise explizite mentale Repräsentationen zu verwenden. Diese Fähigkeit ist verwoben mit der Art und Weise, wie Organismen ihre Relevanzrealiserung betreiben und so neue Handlungsmöglichkeiten erschließen. Im Zuge der Evolution hat sich dieser adaptive Mechanismus weiter komplexifiziert. Organismen interagieren mit ihrer Umwelt im Sinne von Affordanzen – das sind je nach Kontext opportunistische oder hinderliche Aspekte der Umgebung, die als Chancen oder Risiken für das Organismusziel wahrgenommen werden.
Ziele, Handlungen und Affordanzen existieren nicht isoliert, sondern formen eine wechselseitige, dynamische Beziehung, durch die Organismen fortlaufend ihre Handlungsräume schaffen und anpassen. Dieser Prozess ist weder vollständig deterministisch noch algorithmisch fassbar, sondern basiert auf kontinuierlicher Evaluierung, Anpassung und Emergenz. Diese Perspektive führt zu einem Paradigmenwechsel in unserer Auffassung von Kognition und natürlicher Agentur. Statt Agentur und Wissen als Formen komplizierter Berechnung zu interpretieren, müssen wir sie als emergente Phänomene begreifen, die aus einer besonderen Organisationsform lebender Systeme und deren evolutionärer Geschichte hervorgehen. Das bedeutet, dass alle Formen von Intelligenz – von der einfachsten sensorischen Reaktion eines Bakteriums bis hin zu bewusstem Denken beim Menschen – in einem abgestuften Kontinuum von Relevanzrealisierung verankert sind, das jedoch nicht auf rein algorithmische Prinzipien reduzierbar ist.
Für die Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz ergibt sich daraus eine fundamentale Einsicht: Eine Maschine, die ausschließlich auf formale, vorgegebene Abläufe und festgelegte Datenstrukturen zurückgreift, kann niemals vollständige natürliche Agentur erlangen, weil ihr die intrinsische Zielsetzung und die Fähigkeit fehlen, in unbestimmten Situationen eigenständig Relevanz zu erkennen und neue Handlungsrahmen zu erstellen. Das veranschaulicht das sogenannte „Frame Problem“ der KI, das nicht einfach durch komplexere Algorithmen lösbar ist. Stattdessen muss die Entwicklung wirklich selbstbestimmter und adaptiver Agenten ein Verständnis und eine Einbeziehung lebendiger organisatorischer Prinzipien und offener, unabschließbarer Anpassungsprozesse einschließen. Ein solcher Ansatz wäre eine Verbindung von biologischer Organisationstheorie, Antizipation und ökologischem Denken, die das Zusammenspiel von intrinsischen Zielen, Handlungsfreiheit und Umweltbeziehungen in den Mittelpunkt rückt. Darüber hinaus verdeutlicht diese Sichtweise, dass das menschliche Bewusstsein und das rationale Denken keine isolierten oder rein rational formalen Fähigkeiten sind, sondern auf einer biologischen Basis von relevanter Sinngebung und adaptive Handlungsorientierung aufbauen.
Kognition und Bewusstsein sind demnach evolutive, emergente Phänomene, die auf der tief verwurzelten Fähigkeit natürlichen Lebens beruhen, Bedeutung aus einer unüberschaubaren Welt zu generieren und so „Leben zu wissen“. Der daraus resultierende Begriff der „agentialen Emergenz“ beschreibt die Organismen als Systeme, deren Handlungen und kognitive Prozesse untrennbar mit ihrer lebendigen Organisation verbunden sind – und die deshalb nicht durch algorithmische Programme vollständig erklärbar oder simuliebar sind. Dies hat nicht nur Einfluss auf die Grundlagenforschung, sondern auch auf praktische Felder wie die Ethik der KI, indem es unterstreicht, dass Maschinen niemals echte Fürsorge oder moralisches Verantwortungsbewusstsein entwickeln können, weil ihnen die lebensweltliche Dimension der Relevanzwahrnehmung fehlt. Abschließend lässt sich sagen, dass Agentur und Kognition als Phänomene lebendiger Systeme sich über rein mechanistische oder berechenbare Modelle hinausbewegen. Sie basieren auf einem komplexen Zusammenspiel von Selbstorganisation, Intrinsizität von Zielen, evolutionärer Anpassung und dynamischer Sinnerzeugung.
Dieses Verständnis öffnet den Weg für neue wissenschaftliche und philosophische Perspektiven auf das Leben selbst, zeigt die Grenzen der aktuellen Technologien auf und fordert eine tiefere Annäherung an die Bedingungen natürlicher Intelligenz und bewusster Erfahrung.