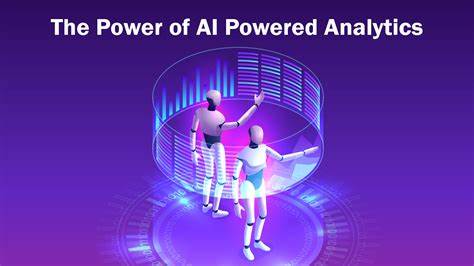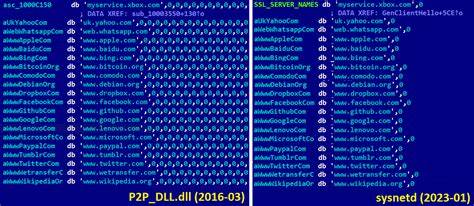In der Hospiz- und Palliativversorgung steht der Mensch im Mittelpunkt – als fühlendes, denkendes und oft angstvolles Wesen bis zum letzten Augenblick. Im dänischen Hvidovre Krankenhaus nahe Kopenhagen wurde eine Palliativstation mit dem Ziel eingerichtet, nicht nur die körperlichen Schmerzen schwerstkranker Patienten zu lindern, sondern gleichzeitig auch ihre seelischen Ängste, vor allem die Furcht vor dem Tod, anzunehmen und zu behandeln. Was diese Station von anderen Krankenhausbereichen unterscheidet, ist ein ganzheitlicher Ansatz, der den untrennbaren Zusammenhang zwischen körperlichem Schmerz und seelischem Leid ernst nimmt und gezielt darauf abzielt, beide zu mildern. Auf dieser Station wird den Patienten nicht mehr mit dem Ziel der Heilung begegnet. Stattdessen liegt das Augenmerk auf der Linderung von Symptomen wie Schmerzen, Übelkeit und Atemnot.
Doch die Herausforderung besteht darin, dass Leiden am Lebensende nicht nur physisch, sondern auch existenziell ist. Das bedeutet, dass viele Patienten zusätzlich zu den körperlichen Beschwerden mit Ängsten, Unsicherheit und oft mit der Angst vor dem Loslassen und der Endlichkeit kämpfen. Ärzte und Pflegepersonal auf dieser Station verstehen diese Kombination als „totalen Schmerz“. Dies ist ein Konzept, das besagt, dass körperliche Schmerzen durch seelische und soziale Leiden verstärkt werden können. Dr.
Johan Randén, ein erfahrener Facharzt für Palliativmedizin, betont, wie wichtig es ist, mit den Patienten offen über ihre Todesangst zu sprechen. Er sorgt dafür, dass niemand sich allein gelassen fühlt mit den tiefsten Ängsten. Die Gespräche mit den Patienten sind dabei nicht nur medizinischer Natur, sondern oft sehr persönlich: Es geht um Erinnerungen, Abschiednehmen und das Ausdrücken ungelöster Gefühle. Die Atmosphäre auf der Station ist ruhig und würdevoll, ein bewusster Gegensatz zum oft hektischen Betrieb anderer Krankenhausbereiche. Pflegekräfte wie Sigrid Nielsen, die seit Jahren in der Palliativpflege tätig ist, schaffen mit geduldiger und einfühlsamer Zuwendung einen sicheren Raum.
Dort dürfen die Patienten ihre Gefühle zeigen – ob Wut, Trauer oder Angst. Sie werden gehalten und respektiert, sodass sie ihre Ängste nicht verstecken müssen. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist es auch, die Angehörigen in den Prozess einzubeziehen. Für viele Familien sind die letzten Tage eines geliebten Menschen von großer Unsicherheit und Schmerz geprägt. Hier greifen Ärzte und Pflegepersonal gleichermaßen unterstützend ein.
Sie helfen den Hinterbliebenen durch Gespräche, Informationen und beistehende Fürsorge, ihre eigene Trauer zu verarbeiten und den Abschied würdevoll zu gestalten. Das Konzept, das auf dieser Station praktiziert wird, stellt sich bewusst der kontroversen Debatte um das Thema assistierter Sterbehilfe. Während einige politische Kräfte in Dänemark die Legalisierung der medizinisch assistierten Selbsttötung vorantreiben, zeigt die Arbeit der Palliativstation, welche Alternativen es gibt, um das Lebensende schmerzfrei und angstfrei zu gestalten. Patienten werden nicht alleine gelassen mit dem Wunsch, ihr Leben aus eigener Hand zu beenden, sondern sie erhalten Unterstützung, die ihnen erst ermöglicht, den Wunsch loszulassen und die verbleibende Zeit in Frieden und Würde zu verbringen. Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Fall von René Damgaard, einem Mann, der auf der Station gepflegt wurde.
Er litt unter weit fortgeschrittenem Krebs mit starken Schmerzen. René wollte keine Chemotherapie mehr und wünschte sich, seine verbleibende Zeit ohne zusätzliche Belastung zu verbringen. Durch die intensive Betreuung konnte sein Schmerz durch eine Kombination aus Medikamenten und Zuwendung gut kontrolliert werden. Zusätzlich half das Pflegepersonal ihm, seine existentielle Angst zu überwinden, in dem sie Gespräche ermöglichten, Abschiede vorbereiteten und Nähe gaben, wenn es besonders schwer war. René durfte schließlich in Würde und mit Liebe umgeben sterben – ein Ziel, das für die Mitarbeiter der Station an erster Stelle steht.
In einer Welt, in der der Tod oft tabuisiert wird, leisten diese Palliativteams eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe: Sie machen das Lebensende transparent und annehmbar. Sie eröffnen Raum für tiefe emotionale und spirituelle Bedürfnisse, die sonst viel zu selten beachtet werden. Der Tod wird nicht als Versagen der Medizin gesehen, sondern als natürlicher Teil des Lebens, dem mit Respekt und Mitgefühl begegnet werden muss. Dieses Modell einer umfassenden Betreuung, das körperliche Schmerzen ebenso ernst nimmt wie Ängste vor dem Tod, setzt Maßstäbe, die auch außerhalb Dänemarks beispielhaft sein können. Es zeigt, wie medizinische Fürsorge und menschliche Wärme sich ergänzen können, um das Lebensende für alle Beteiligten so lebenswert und friedlich wie möglich zu gestalten.
Der Abschiedsschmerz wird durch eine achtsame Begleitung nicht kleiner, doch er wird erträglicher, wenn Patienten und Angehörige wissen, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Trauer und ihren Ängsten. Die Herausforderungen, die mit dem Tod verbunden sind, erfordern außerdem eine enge Zusammenarbeit von Ärzten, Pflegern, Psychologen, Sozialarbeitern und Seelsorgern. Nur gemeinsam können sie den komplexen Bedürfnissen der Sterbenden und deren Umfeld gerecht werden. Dabei ist eine offene Kommunikation essenziell, besonders in Bezug auf die Planung der letzten Lebensphase und die Wünsche der Patienten. Die Erfahrung zeigt, dass viele Menschen erst durch eine ehrliche und liebevolle Begleitung die Angst vor dem Unausweichlichen langsam loslassen und mehr Frieden finden.
In der Palliativmedizin geht es nicht darum, das Leben künstlich zu verlängern, sondern die Lebensqualität zu erhalten und Leiden zu lindern. Dies umfasst auch die Unterstützung durch Medikamente, psychologische Betreuung, spirituelle Begleitung und soziale Fürsorge. Die Patientinnen und Patienten werden als Individuen gesehen, deren Lebensgeschichte und Wünsche in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Arbeit auf der Palliativstation erinnert uns daran, dass der Tod ein natürlicher Lebensabschnitt ist, der nicht nur Furcht, sondern auch Würde und Menschlichkeit verdient. Klinikinstitutionen, die diesen Ansatz verfolgen, leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass Menschen ihren letzten Weg in Frieden gehen können – frei von unerträglichen Schmerzen und Ängsten.
Sie zeigen, dass Sterben nicht das stille Leiden ist, das viele fürchten, sondern eine Phase, in der Mitgefühl und Begleitung das Leben noch einmal mit Sinn erfüllen können. Dieser intensive Einblick aus Dänemark kann als Weckruf für viele Gesundheitssysteme dienen, die Palliativversorgung und psychische Begleitung am Lebensende weiter zu stärken. Denn es geht letztlich um die Frage, wie wir als Gesellschaft mit der Endlichkeit umgehen – und wie wir sicherstellen, dass jeder Mensch seine letzten Tage in Würde und möglichst ohne Angst verbringen darf. Die Verbindung von medizinischer Kompetenz und menschlicher Zuwendung macht dabei einen entscheidenden Unterschied.