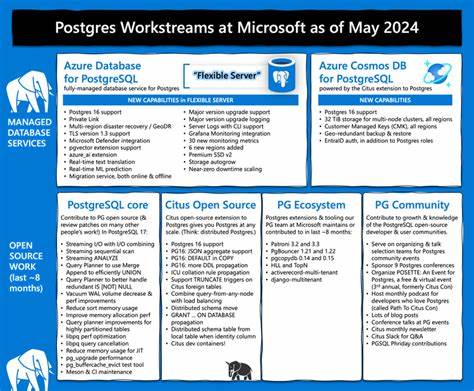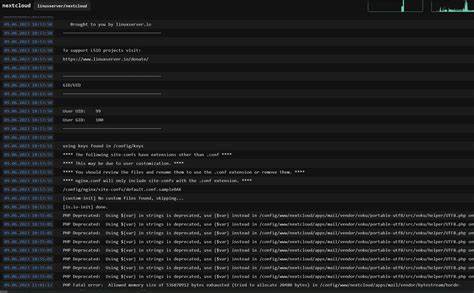Flughäfen sind für die meisten Menschen Orte der Hektik, geprägt von Sicherheitskontrollen, Abflug- und Ankunftshallen sowie dem geschäftigen Treiben rund um die Passagiere und Flugzeuge. Doch hinter den Kulissen gibt es noch einen anderen wichtigen Verkehr, den man leicht übersieht: den Flugverkehr der Vögel. Am Portland International Airport (PDX) gibt es ein ganz besonderes Team von Fachleuten, das die Aufgabe hat, Vogelschlag zu verhindern und somit das Zusammentreffen von Vögeln und Flugzeugen sicher zu steuern. Im Mittelpunkt steht Nick Atwell, Senior Natural Resources & Wildlife Manager am Port of Portland, dessen Arbeit ebenso spannend wie herausfordernd ist. Seine tägliche Mission ist es, Leben zu schützen – sowohl von Menschen als auch von Vögeln.
Die Aufgabe des Vogelkontrollmanagers ist dynamisch, vielfältig und anspruchsvoll. Nick Atwell und sein Team aus sechs Biologen patrouillieren täglich von frühmorgens bis zum Nachmittag das gesamte Flughafengelände, beobachten aufmerksam das Verhalten der Vögel und setzen gezielt Maßnahmen um, um die Tiere vom Flugfeld fernzuhalten. Die Herausforderung liegt darin, den natürlichen Lebensraum zu berücksichtigen, ohne dabei die Flugsicherheit zu gefährden. Am Flughafen Portland ist diese Aufgabe besonders komplex, da sich der Flughafen am Schnittpunkt zweier großer Flusssysteme befindet und zudem auf dem so genannten Pacific Flyway, einer der wichtigsten Vogelzugrouten Nordamerikas, liegt. Dies bedeutet eine hohe Dichte an Zugvögeln und eine ständige Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen Naturschutz und luftfahrtsicherer Umgebung zu schaffen.
Zur Ausführung ihrer Arbeit verfügt das Vogelschutzteam über eine Vielzahl moderner Werkzeuge. Tagsüber kommen Ferngläser zum Einsatz, mit denen sie genau beobachten können, welche Vogelarten auf dem Gelände unterwegs sind. In den dunkleren Stunden helfen Wärmebildgeräte, um Vögel auch bei schlechter Sicht aufzuspüren. Ein besonders spannendes Hilfsmittel ist der grüne Laser, der besonders für Vögel abschreckend wirkt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Augenstruktur sehen Vögel das Laserlicht nicht nur als einzelne Punkte, sondern als durchgehenden Lichtstrahl, der an ein Lichtschwert erinnert und sie deshalb eher zur Flucht veranlasst.
Außerdem setzt das Team auf 30 solarbetriebene, mit Propangas betriebene Kanonen, die kontrollierte laute Knallgeräusche erzeugen, um Vögel auf dem gesamten 11.000 Fuß langen Rollfeld zu vertreiben. Die Arbeit geht jedoch weit über simple Abschreckung hinaus. Das Team greift bei Bedarf auf human gefangene Fallen zurück, die speziell für Greifvögel entwickelt wurden. Diese Fallen funktionieren mit kleinen Lockvögeln wie Staren oder Mäusen, die unharmed bleiben.
Im Falle einer erfolgreichen Fangktion wird der Greifvogel sorgfältig vermessen, markiert und in ein geeigneteres Gebiet umgesiedelt – meist zwei bis drei Autostunden vom Flughafen entfernt. Diese Umsiedlungsmaßnahmen folgen den natürlichen Zugrouten der Vögel und dienen dazu, Konflikte mit Flugzeugen vor Ort zu minimieren, ohne der Vogelpopulation zu schaden. Besonders stolz ist Nick Atwell auf das Raptoren-Umsiedlungsprogramm, das seit 1999 mehr als 1.800 Rotmilanen neues Terrain jenseits des Flughafens bietet. Die Erfassung der Vogelbewegungen wird durch die Markierung mit farblich auffälligen Flügeltags unterstützt, die Vogelbeobachter und Naturliebhaber ermutigen, Sichtungen zu melden.
Diese Daten fließen unmittelbar in die strategische Planung ein und verbessern kontinuierlich die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen. Die Prävention beginnt jedoch bereits auf dem Flughafengelände selbst, weit vor der physischen Vogelsichtung. Auch bei der Auswahl und Pflege der Vegetation wird durchdacht vorgegangen: Baumarten mit dicht verzweigten Ästen werden bevorzugt, um die Anzahl der möglichen Sitzplätze für Vögel zu reduzieren. Zudem wird darauf geachtet, dass der Rasen entlang der Landebahnen mit speziellen Gräsern bepflanzt wird, die für Gänse und andere Vögel unattraktiv sind. Offene Wasserflächen, die Vögel anziehen könnten, werden durch den Einsatz von tausenden schwarzen Plastikbällen auf Wasserreservoiren optisch verborgen und somit weitgehend unzugänglich gemacht.
Neben den Vögeln spielt auch die Kontrolle von Säugetieren wie z.B. Kojoten eine Rolle. Diese Tiere können durch das Überqueren der Start- und Landebahnen zu einer Gefahr werden. Der Flughafen hat spezielle Schutzmaßnahmen ergriffen, indem etwa der Zaun rund um das Gelände so in den Boden eingelassen und angewinkelt wurde, dass Grabenversuche nicht erfolgreich sind.
Der Job verlangt von Nick Atwell und seinem Team nicht nur ein ausgeprägtes Wissen über Naturschutz und Ökologie, sondern auch eine hohe Kompetenz im Bereich der Luftfahrt. Die enge Zusammenarbeit und ständige Kommunikation mit dem Flugverkehrskontrollzentrum sind essenziell, damit alle Partner auf dem neuesten Stand bleiben und unmittelbar auf potenzielle Gefahren reagieren können. Multitasking und situatives Bewusstsein sind daher wichtige Eigenschaften für jeden Vogelkontrolleur am Flughafen. Trotz der technischen Hilfsmittel bleibt die Arbeit handlungsorientiert und manchmal auch von persönlichem Engagement geprägt. So erinnert sich Atwell lebhaft an die Rettung eines verletzten Weißkopfseeadlers, die sich als besonders herausfordernd und unvergesslich erwies.
Auch wenn die Ausrüstung hochentwickelt ist, kann ein einfacher Gegenstand wie eine Decke entscheidend sein, um verletzte Vögel sicher und schonend einzufangen. Die Tätigkeit als Vogelkontrolleur am Flughafen Portland eröffnet darüber hinaus vielfältige Ausbildungschancen. Während ein Bachelorabschluss mit Schwerpunkt Botanik oder Naturschutz empfohlen wird, legt die Federal Aviation Administration inzwischen besonderen Wert auf eine formelle Qualifikation als Airport Wildlife Technician. Praktische Erfahrung vor Ort und das Verständnis für die komplexen Abläufe am Flughafen sind unersetzlich. Der Port of Portland bietet darüber hinaus seit Jahren Praktikumsplätze an, die es naturverbundenen jungen Menschen ermöglichen, einen Einblick in diese anspruchsvolle Karriere zu bekommen.
Ein weiteres interessantes Feld ist die Erhaltung bedrohter Arten direkt am Flughafen. So profitiert etwa die vom Aussterben bedrohte Streaked Horned Lark von vom Team gepflegten, kahlen Flächen, die gleichzeitig verhindern, dass größere und damit für den Flugverkehr problematischere Arten wie Wildgänse sich dort ansiedeln. Dieses fein austarierte Management zeigt, dass Flughäfen nicht nur als Verkehrsknotenpunkte verstanden werden müssen, sondern auch als komplexe Lebensräume, die gezielt geschützt und gepflegt werden können. Das Engagement von Nick Atwell und seinem Team verdeutlicht, wie vielfältig und bedeutend die Aufgabe des Vogelschutzes für die Flugsicherheit ist. Die Herausforderung, natürliche Vogelbewegungen zu respektieren und gleichzeitig Risiken für den Flugverkehr zu minimieren, verlangt ein hohes Maß an Wissen, Fingerspitzengefühl und innovativen Lösungen.
So wird am Flughafen Portland Tag für Tag an der Schnittstelle von Natur und hochmoderner Luftfahrtsicherheit gearbeitet – eine Arbeit, die genauso wichtig ist wie die der Fluglotsen in den Kontrolltürmen. Die Zukunft sieht vielversprechend aus: Mit den internationalen Gesprächen und Konferenzen wie Bird Strike USA, die 2025 in Portland stattfinden, wächst die Aufmerksamkeit für das Thema weltweit. Das Engagement und die Erfahrung des Port of Portland tragen dazu bei, Sicherheitsstandards zu verbessern, neue Strategien zu entwickeln und der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, wie wichtig eine harmonische Koexistenz zwischen Maschinen und Natur im Luftverkehr ist. Nick Atwell und sein Team zeigen uns, dass ein Blick in die Lüfte nicht nur Flugzeuge, sondern auch die faszinierende Vogelwelt mit einschließt – und dass beide eine sichere Reise verdienen.