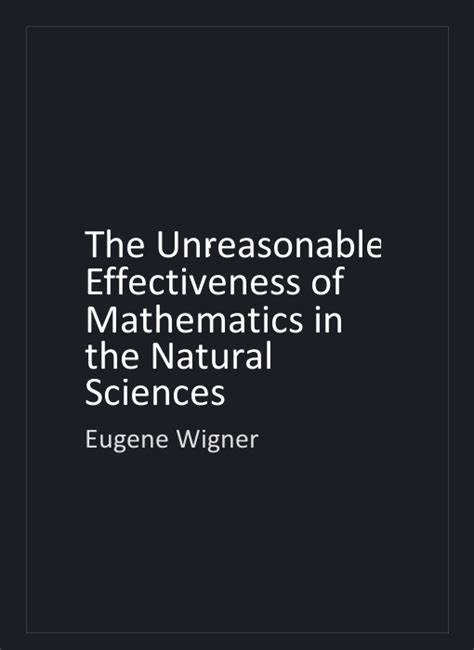In einer Welt, in der Lesestoff oft schnell konsumiert und ebenso schnell beiseitegelegt wird, sticht ein Buchclub in Austin, Texas, als bemerkenswertes Beispiel für Ausdauer und Hingabe hervor. Seit über zwölf Jahren beschäftigen sich Mitglieder dieses Clubs mit einem der schwierigsten literarischen Werke des 20. Jahrhunderts: Finnegans Wake von James Joyce. Dieses Buch, erstmals 1939 veröffentlicht, entzieht sich konventionellen Erzählstrukturen, kombiniert mehrere Sprachen und fordert Leser*innen mit einer experimentellen Prosa immer wieder heraus. Die Lesegruppe hat sich deshalb auf eine langsame, intensive Reise eingelassen, um das Werk nicht nur zu lesen, sondern mit Leben zu füllen und gemeinsam zu entschlüsseln.
Finnegans Wake ist alles andere als ein gewöhnlicher Roman. Die Geschichte beginnt und endet mit demselben fragmentarischen Satz, der die Form eines Kreislaufs hat, in dem die Realität und Zeit ineinanderfließen. Die Sprache ist ein Kaleidoskop aus Wortneuschöpfungen, fremdsprachlichen Elementen, phonetischen Experimenten und literarischen Anspielungen, was das Verständnis für viele Leser*innen nahezu unmöglich macht. Doch genau diese Herausforderung hat die Austin Gruppe unter der Leitung von Peter Quadrino angezogen. Quadrino, selbst ein ausgewiesener James Joyce Experte, gründete den Lesekreis mit der Intention, jede Seite gemeinsam aufzuschlüsseln und zu analysieren.
Die Treffen finden mittlerweile alle zwei Wochen online per Zoom statt, mit Teilnehmer*innen aus aller Welt. Vor Beginn der eigentlichen Lesezeit halten die Mitglieder etwa 15 Minuten lang einen informellen Austausch, der den Zusammenhalt und die Gemeinschaft stärkt. Danach folgt die Lesung: Jede Person liest reihum zwei Zeilen, bis die gesamte Seite bewältigt ist. Die eigentliche Arbeit beginnt dann in der anschließenden Diskussionsrunde. Die Gruppe widmet sich intensiv der Sprache, erforscht Anspielungen, teilt Interpretationen und versucht, das unnachgiebige Dickicht von Joyces Sprache gemeinsam zu durchdringen.
Um der Komplexität gerecht zu werden, wurde die ursprüngliche Lese-Rhythmik von zwei Seiten pro Treffen auf eine Seite pro Sitzung reduziert. Die methodische Herangehensweise macht deutlich, dass es der Gruppe nicht darum geht, schnell fertig zu werden. Im Gegenteil: Die Langsamkeit und das ständige Zurückkehren zu einzelnen Satzfragmenten und sprachlichen Besonderheiten sind Teil der Faszination. Die Lektüre wird zu einer gemeinsamen Forschungsreise, bei der die Freude im Verstehen und Austausch liegt – anstatt im Abschluss des Buches. Quadrino selbst gibt zu, dass der Gedanke ans Ende der Lektüre gar nicht wirklich präsent ist.
Sollte die Gruppe Finnegans Wake tatsächlich einmal von vorne bis hinten durchgearbeitet haben, wollen sie einfach wieder von vorn beginnen. Die Bedeutung dieses Projekts liegt auch darin, dass Finnegans Wake trotz seiner Schwierigkeit eine bleibende Faszination entfaltet. Weltweit entstanden ähnliche Lesegruppen in Städten wie Dublin, New York oder Seattle, die sich der Herausforderung stellen, das literarische Werk zu entschlüsseln. Jeder dieser Kreise nimmt eine andere Perspektive ein, zeigt aber eine gemeinsame Leidenschaft für Literatur, die jenseits von Unterhaltung und einfacher Erzählung steht. Es ist eine Form intellektueller Gemeinschaft, die die Liebe zur Sprache und zu komplexen Texten feiert.
Außerhalb der virtuellen Welt traf sich die Gruppe früher auch regelmäßig im Malvern Books, einem unabhängigen Buchladen in Austin, der als Treffpunkt für Literaturinteressierte in der Region viele kulturelle Aktivitäten fördert. Neben der reinen Lesetätigkeit hat der Buchladen dazu beigetragen, den Austausch zwischen Literaturenthusiasten zu stärken und diesem außergewöhnlichen Projekt einen festen Ort zu verleihen. Peter Quadrinos Engagement für James Joyce geht weit über den Buchclub hinaus. Als anerkannter Joyce-Gelehrter hat er an Konferenzen in mehreren Ländern teilgenommen und dadurch ein internationales Netzwerk von Gleichgesinnten aufgebaut. Seine Leidenschaft spiegelt sich in den Treffen wider und ist für viele Teilnehmer*innen ansteckend.
Diese Verbindung von akademischem Interesse und gemeinschaftlicher Leseerfahrung schafft eine einzigartige Atmosphäre, die weit über das bloße Buch hinausgeht. Was kann man aus diesem außergewöhnlichen Leseprojekt lernen? Es zeigt, dass Lesen nicht immer mit Geschwindigkeit zu tun haben muss, sondern ebenso eine intensive und gemeinschaftliche Erfahrung sein kann. Gerade bei anspruchsvoller Literatur können Leser*innen von Diskussionen, gemeinsamen Interpretationen und dem langsamen Erkunden von Texten profitieren. Ein Buch wie Finnegans Wake zu lesen, verlangt Geduld, Offenheit und die Bereitschaft, sich auf ein Abenteuer einzulassen, dessen Ziel nicht in der schnellen Fertigstellung liegt, sondern im Prozess selbst. Außerdem demonstriert der Buchclub in Austin, wie moderne Technologien wie Zoom es ermöglichen, Menschen aus aller Welt zusammenzubringen, die ein spezielles Interesse teilen.
Diese globale Vernetzung erweitert den Horizont jeder Teilnehmerin und jedes Teilnehmers und macht die Lektüre zu einem kulturellen Austausch. Letztlich verweist das Projekt auch auf ein wichtiges Thema im literarischen Leben: Die Bedeutung von Gemeinschaft und Gespräch. Bücher entfalten ihre Wirkung nicht nur auf dem Papier, sondern vor allem in der Interaktion zwischen Leser*innen. Der Austausch von Gedanken und Ideen fördert tiefere Einsichten und macht das Lesen zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis. Der Finnegans Wake Reading Group in Austin gelingt es, mit Geduld und gemeinsamer Anstrengung ein Werk zu erschließen, das sonst für viele unzugänglich bleibt.
Die Gruppe zeigt, dass Literatur ein lebendiger Bestandteil des kulturellen Lebens sein kann, wenn Leser*innen sich Zeit nehmen, zweifeln, erforschen und miteinander diskutieren. Und so ist ihre Reise durch James Joyces Meisterwerk nicht nur eine Geschichte von Hindernissen, sondern vor allem von Leidenschaft und der Freude am gemeinsamen Forschen und Verstehen.



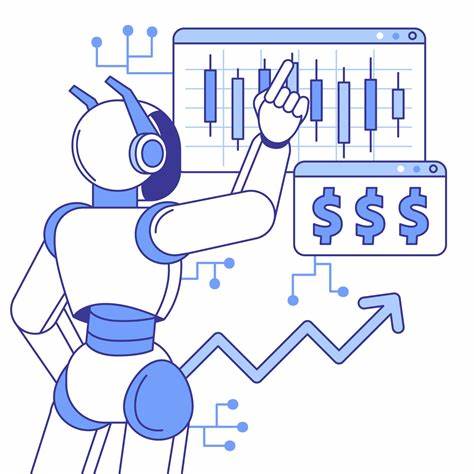
![Writing Greener Software Even When You Are Stuck On-Prem [video]](/images/D0A5CF35-03AB-4EC2-8169-BB76F517A4BA)