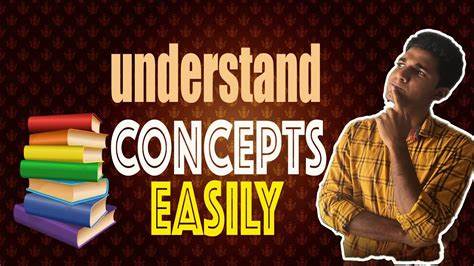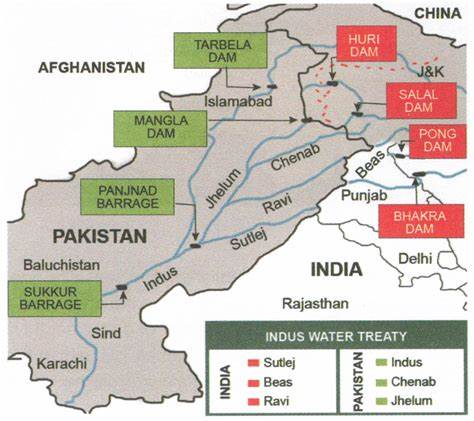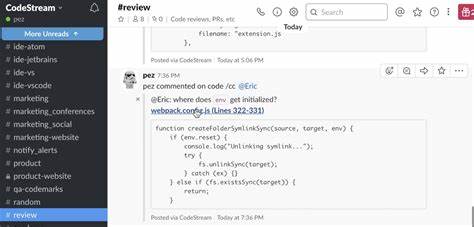Die Geschichte um den sogenannten päpstlichen Toilettenstuhl, auch bekannt unter dem lateinischen Begriff „sedes stercoraria“, hat im Laufe der Jahrhunderte immer wieder für Faszination und Spekulation gesorgt. Angeblich soll es sich hierbei um einen speziellen Stuhl mit einem Loch handeln, auf dem neu gewählte Päpste im Mittelalter Platz nehmen mussten, um einer intimen Geschlechtsprüfung zu unterziehen. Ziel dieser Praxis sollte es gewesen sein, sicherzustellen, dass der Oberhaupt der katholischen Kirche tatsächlich ein biologischer Mann war und somit nicht etwa eine verkleidete Frau das höchste Amt der Kirche bekleiden konnte. Doch wie viel Wahrheit steckt wirklich hinter dieser bizarren Legende und was sagt die Forschung dazu? Der Mythos des päpstlichen Toilettenstuhls lässt sich nicht ohne weiteres von historischen Tatsachen trennen, da er eng mit der sagenhaften Figur der sogenannten Päpstin Johanna verknüpft ist. Die Erzählung von Päpstin Johanna ist vermutlich eine mittelalterliche Legende um eine Frau, die unter männlicher Identität in den höchsten kirchlichen Rang aufstieg und erst enttarnt wurde, als sie während eines Prozessionszuges ersichtlich schwanger wurde.
Diese Geschichte war in der Tat populär und füllte zahlreiche Schriften und mündliche Überlieferungen, obwohl die Existenz von Johanna unter Historikern nach wie vor stark umstritten ist und als sehr unwahrscheinlich gilt. Viele Gelehrte sehen in ihr eher eine Erzählfigur, die patriarchale Ängste und die Herrschaftsansprüche der Kirche symbolisch widerspiegelt. Der päpstliche Toilettenstuhl geht offenbar viel mehr auf diese Legende zurück als auf tatsächliche historische Praktiken. Das angebliche Ritual, bei dem frisch ernannte Päpste ihren Geschlechtsmerkmalen offenlegen mussten, wird in wissenschaftlichen Kreisen zumeist als Erfindung entlarvt, die vor allem dazu diente, die Vorstellung eines weiblichen Papstes zu widerlegen oder zumindest die Möglichkeit ihrer Existenz ins Lächerliche zu ziehen. Einige Chroniken berichten von karikaturhaften Ritualen, bei denen ein Arzt vor versammeltem Publikum die Männlichkeit bestätigte, indem er das Offensichtliche verkündete.
Diese groteske Zeremonie sollte eher abschreckender Humor oder spöttische Übertreibung gewesen sein, als ein fester Bestandteil päpstlicher Krönungsrituale. Die wissenschaftliche Forschung, darunter Studien von Historikern wie Thomas F. X. Noble, fanden keine glaubwürdigen Belege dafür, dass eine derartige Sedes stercoraria jemals tatsächlich zum Einsatz kam. Es handelt sich um eine Mischung aus mittelalterlichen Gerüchten, Scheingeschichten und späterer historischer Überinterpretation.
Es wird vermutet, dass die Erzählung vor allem im 16. Jahrhundert an Popularität gewann, als bereits mehrere Päpste bekannt dafür waren, uneheliche Kinder gezeugt zu haben – wodurch die Notwendigkeit einer derartigen Prüfung gegenstandslos wurde. Die Legende um den sogenannten päpstlichen Toilettenstuhl zeigt aber auch viel über die gesellschaftlichen Vorstellungen und Ängste jener Zeiten. Die katholische Kirche war über Jahrhunderte hinweg patriarchalisch strukturiert, und das Papsttum galt als das wichtigste männliche religiöse Amt überhaupt. Die bloße Idee, eine Frau habe dieses Amt übernehmen können, führte zu großer Faszination, aber auch zu großer Angst und Ablehnung.
Die Legende der Päpstin Johanna spiegelt somit eine historische Machtdynamik wider, die von Geschlechterrollen, Kontrolle und dem Schutz von Institutionen geprägt ist. Ein weiterer Grund für die hartnäckige Verbreitung der Geschichte mag darin liegen, dass sie ein gewisses Maß an makabrem Humor und Sensationslust bedient. Der Gedanke an eine derart peinliche Prozedur war nicht nur gruselig, sondern auch unterhaltend – selbst wenn er erfunden war. Der päpstliche Toilettenstuhl wurde in vielen historischen Darstellungen, Filmen und literarischen Werken aufgegriffen und hat sich so als ein fast schon symbolträchtiges Objekt im Kulturgedächtnis manifestiert. Es ist aber wichtig zu betonen, dass es keinerlei archäologische Funde oder verlässliche zeitgenössische Dokumente gibt, die die Existenz eines solchen Stuhls belegen könnten.
Auch päpstliche Zeremonien, wie sie in Kirchenchroniken beschrieben werden, sind dieser unangenehmen legislativen Praxis völlig unverdächtig. Die Kategorie der sogenannten „Peinlichkeiten“ bei herrschaftlichen Zeremonien war im Mittelalter durch andere Rituale besser abgedeckt – bloß allerdings nicht durch eine Genitaluntersuchung. Betrachtet man die Motive für die Entstehung und Verbreitung dieses Mythos aus heutiger Sicht, wird deutlich, wie sich historische Mythen entwickeln und welche Funktionen sie erfüllen können. Gerade in Zeiten von Unsicherheit und Konkurrenz – etwa um die Legitimität kirchlicher Herrschaft – bieten solche Geschichten Ankerpunkte und Wegweiser für kollektive Ängste. Doch sie können auch zu Missverständnissen und falschen Bildern führen, die bis in die Gegenwart nachwirken.
Die Geschichte vom päpstlichen Toilettenstuhl ist ein gutes Beispiel für eine Legende, die im Kern zwar nicht wahr ist, jedoch wichtige Einblicke in mittelalterliche Gedankenwelt und kirchliche Machtstrukturen gibt. Sie zeigt, wie Geschichte und Mythos ineinanderfließen können, und wie wichtig es ist, zwischen belegbaren Fakten und Fiktionen zu unterscheiden. Trotz ihres zweifelhaften Wahrheitsgehaltes hat die Erzählung nichts von ihrer Faszination verloren. Im Gegenteil: Sie inspiriert weiterhin Forschung, Literatur und Popkultur. Durch kritische Auseinandersetzung können wir nicht nur die historische Realität besser verstehen, sondern auch reflektieren, wie sich Macht, Geschlecht und Wahrheit in Legenden spiegeln.
Zusammenfassend darf festgehalten werden, dass der päpstliche Toilettenstuhl wohl eher ein Produkt der Fantasie war als eine gelebte Wirklichkeit innerhalb des Vatikan. Die Geschichte diente dazu, die Angst vor einer weiblichen Papstgewalt zu bannen und gleichzeitig eine skurrile, fast schon groteske Erinnerung an mittelalterliche Vorstellungen von Macht und Geschlecht zu bewahren. Die wahre Herausforderung besteht darin, die Legende in ihrem kulturellen und historischen Kontext zu verstehen und nicht als bare Münze zu nehmen. So zeigt sich, dass Mythen wie diese den Reiz besitzen, die Vergangenheit lebendig und spannend zu gestalten, ohne dabei immer auf historischer Genauigkeit zu basieren.