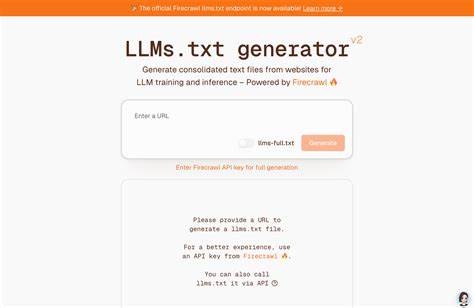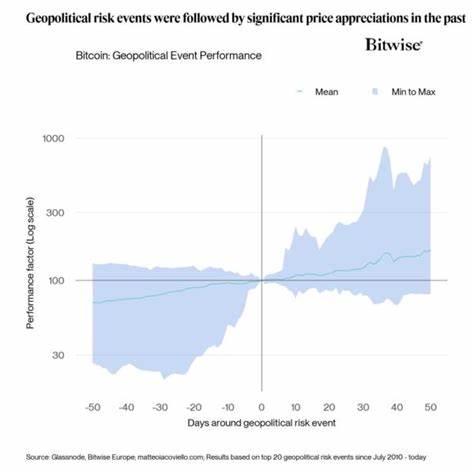Die Entwicklung von Software ist ein komplexer Prozess, der weit über das reine Programmieren hinausgeht. Es gibt viele Unsicherheiten und unbekannte Faktoren, die erst im Verlauf des Projekts klar werden. Aus diesem Grund hat sich das Prinzip 'Build It Twice' als besonders effektiv herausgestellt. Dieses Konzept basiert auf der Idee, zunächst einen schnellen und groben Prototyp zu erstellen, um die wesentlichen Zusammenhänge und Anforderungen zu verstehen, bevor das endgültige Produkt mit viel Sorgfalt und Qualität ausgearbeitet wird. Das Kernstück dieser Methode besteht darin, sich bewusst Zeit zu nehmen, um mit einem so genannten 'hacky' End-to-End-Prototyp zu starten.
Dabei steht nicht die Perfektion im Vordergrund, sondern die funktionale Umsetzung einer Idee, um sie verständlich und erlebbar zu machen. Diese erste Version der Software ist oft unübersichtlich, fehlerbehaftet und lässt funktionale Ecken und Kanten zu. Doch genau diese technische Skizze hilft Entwicklern, Annahmen zu überprüfen, mögliche Stolpersteine zu identifizieren und ein echtes Verständnis für die geforderten Funktionen und deren Zusammenwirken zu erlangen. Die Vorteile eines solchen funktionalen Prototyps liegen auf der Hand: Zum einen ermöglicht er ein schnelles Feedback von Nutzern, Kollegen oder Stakeholdern. Zum anderen lässt er Schwachstellen und notwendige Anpassungen frühzeitig sichtbar werden, sodass teure Nacharbeiten in späteren Projektphasen vermieden werden.
Gerade bei komplexen, über mehrere Systeme und Schichten verteilten Anwendungen erweist sich diese Methode als unersetzlich, denn die Interaktion zwischen Backend, Frontend, Datenmodellen und externen Schnittstellen lässt sich oft erst durch einen praktischen Test erfassen. Der nächste Schritt nach dem ersten Prototyp ist das eigentliche „Build It Twice“. Nachdem die grundlegende Machbarkeit bestätigt und die Probleme sowie nötigen Verbesserungen klar geworden sind, folgt der bewusste zweite Bau. Hier gilt es, die Software mit viel mehr Aufmerksamkeit zum Detail und mit Fokus auf sauberen Code, optimale Architektur und umfassende Fehlerbehandlung zu entwickeln. Das Ergebnis ist eine stabilere, wartungsfreundlichere und für die Produktion geeignete Anwendung.
Dieser zweite Bau ist deutlich effizienter, als wenn man ohne vorherigen Prototyp starten würde. Die sogenannte Entdeckungsphase ist bereits abgeschlossen, viele technische Fragestellungen sind gelöst und man hat deutliche Vorstellungen, wie die Anforderungen umgesetzt werden sollen. Das reduziert das Risiko von Fehlschlägen, sorgt für klarere Prioritäten und verbessert die Qualität der Software nachhaltig. Auch wenn anfänglich scheinbar doppelte Arbeit anfällt, bringt es letztlich einen großen Zeitgewinn und Kostenersparnis. Besonders in agilen Arbeitsumgebungen ist die Strategie 'Build It Twice' sehr hilfreich.
Iteratives Arbeiten, schnelles Feedback und kontinuierliche Verbesserung sind zentrale Elemente agiler Methoden. Ein schneller Prototyp ist dabei die perfekte Möglichkeit, um Wünsche der Nutzer oder des eigenen Teams sofort sichtbar zu machen und gezielt darauf einzugehen. Dabei wird in kurzer Zeit ein Minimum Viable Product (MVP) geschaffen, das getestet und verfeinert werden kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die commit-Historie im Versionsverwaltungssystem, beispielsweise Git. Während beim Prototypen die Commits oft chaotisch, unsortiert und sehr experimentell sind, entwickelt sich aus diesem „Rohbau“ in der finale Version ein klar strukturierter, linearer und lesbarer Entwicklungsprozess.
Die saubere Commit-Historie dient dabei nicht nur als Dokumentation, sondern auch als Nachweis der durchgeführten Arbeit und als Referenz bei zukünftigen Änderungen. Während des Prototyp-Baus nimmt man bewusst in Kauf, dass der Code nicht perfekt ist. Man ignoriert Randfälle, lässt Fehlerbehandlung und Validierung zunächst außen vor und konzentriert sich ausschließlich auf das wesentliche Feature. Diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die beim ersten Anlauf sonst leicht übersehen werden könnten. Dabei kann sich herausstellen, dass etwa das Datenmodell angepasst werden muss oder dass neue technische Anforderungen auftauchen, die man vorher nicht eingeplant hatte.
Ein praktisches Beispiel aus der Entwicklung eines Features namens „Dynamic Stamps“ zeigt eindrücklich, wie sinnvoll das Vorgehen ist. Zunächst wurden verschiedene Eigenschaften wie Schriftgröße der Variablen in Pixeln festgelegt. Während der Umsetzung des Anwendungsprozesses wurde jedoch deutlich, dass es deutlich sinnvoller ist, Schriftgrößen relativ zur Bildgröße in Prozent anzugeben. Ohne den ersten, schnell gebauten Prototyp wäre dieser wichtige Aspekt womöglich erst sehr spät oder gar nicht erkannt worden. Nach dem Prototyp ist es sinnvoll, die Arbeit in kleinere, verständliche Schritte aufzuteilen und gut sortiert in das finale Projekt zu überführen.
Dazu werden Änderungen in der Versionskontrolle teilweise zurückgesetzt, überarbeitet und in einer sauberen Reihenfolge erneut committet. So entstehen überschaubare Pull Requests, die es Reviewern erleichtern, Änderungen nachzuvollziehen und die Software schrittweise zu verbessern. Parallel dazu werden offene Aufgaben, die im Prototyp als TODO-Kommentare markiert wurden, systematisch in Tickets überführt und priorisiert. Trotz möglicher Kritik, dass mit 'Build It Twice' vermeintlich doppelte Arbeit anfällt, zeigt die Erfahrung, dass der zweite Build oft deutlich schneller vonstattengeht und zu einem Ergebnis von höherer Qualität führt. Der initiale Prototyp ist dabei kein Zeitverlust, sondern eine konkrete Investition in die Planungssicherheit und Nachhaltigkeit des Projekts.
Zusammenfassend ermöglicht das Prinzip 'Build It Twice' den Umgang mit Unsicherheiten und Komplexität in der Softwareentwicklung. Es fördert eine iterative, lernorientierte Arbeitsweise, die schnelle Prototypen und sorgfältige Umsetzungen verbindet. Dadurch können technische Herausforderungen frühzeitig erkannt, innovative Ideen getestet und am Ende solide, wartbare Softwarelösungen geschaffen werden. Diese Methode empfiehlt sich nicht nur für einzelne Entwickler, sondern vor allem für Teams, die komplexe Produkte mit vielen wechselnden Anforderungen entwickeln. Durch bessere Kommunikation, klarere Struktur und mögliche frühzeitige Fehlererkennung verringert sich die Gefahr von teuren Nacharbeiten und Projektverzögerungen erheblich.
Unternehmen profitieren durch schnellere Time-to-Market, höhere Kundenzufriedenheit und eine stabilere Codebasis. Die Zukunft der Softwareentwicklung liegt in agilen, flexiblen Prozessen und schnellen Feedbackzyklen. 'Build It Twice' ist dabei ein längst bewährtes Mittel, um diese Prinzipien konkret umzusetzen. Wer diese Methode beherrscht, hat einen entscheidenden Vorteil bei der Realisierung komplexer technischer Produkte und bei der Bewältigung anspruchsvoller Herausforderungen im digitalen Zeitalter.
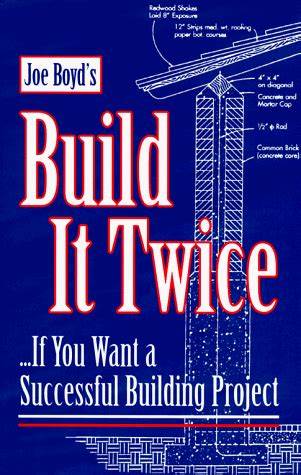



![The Return of Forgotten Math in Computer Graphics [pdf] (2012)](/images/46D59971-5E9D-42D7-AD61-E2FC16A9F283)