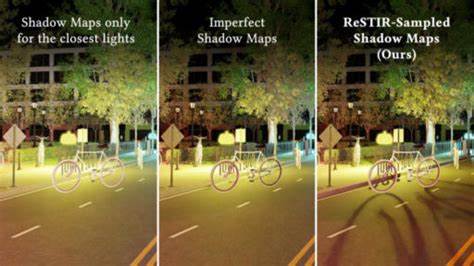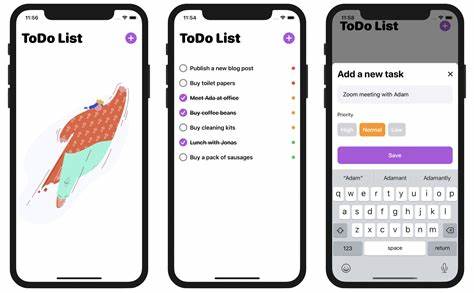Die neoliberale Ökonomie hat in den letzten Jahrzehnten die wirtschaftspolitischen Entscheidungen vieler Länder maßgeblich geprägt. Sie basiert auf einer Reihe von Annahmen, die häufig als grundlegende Wahrheiten über Märkte, Wachstum und individuelle Freiheit dargestellt werden. Diese Annahmen sind jedoch keineswegs unumstritten. Immer häufiger wird kritisiert, dass die neoliberale Ökonomie auf Vorstellungen fußt, die in der Realität nur eingeschränkt oder gar nicht haltbar sind, weshalb sie von manchen als Fantasien bezeichnet werden. Der kritische Diskurs über die neoliberale Theorie ist wichtiger denn je, da ihre Vorstellungen weiterhin großen Einfluss auf politische Entscheidungen mit weitreichenden sozialen Folgen haben.
Die zentrale Idee des Neoliberalismus besteht darin, dass freie Märkte die besten Ergebnisse für Wohlstand und gesellschaftliche Entwicklung erzielen. Der Staat soll sich möglichst wenig in wirtschaftliche Aktivitäten einmischen, um die Effizienz des Marktes zu gewährleisten. Dies beruht auf der Annahme, dass Marktmechanismen wie Angebot und Nachfrage sich selbst regulieren können und dadurch für optimale Allokationen von Ressourcen sorgen. Die Theorie geht zudem davon aus, dass Individuen rational handeln und stets ihr eigenes Interesse verfolgen, was zur Gesamteffizienz beiträgt. Diese starke Orientierung am individuellen Nutzen ist aber eine Vereinfachung komplexer sozialer und wirtschaftlicher Dynamiken.
Kritiker weisen darauf hin, dass Märkte nicht immer rational oder fair funktionieren. Marktmacht, Informationsasymmetrien und externe Effekte führen häufig zu Verzerrungen und Ungerechtigkeiten. Die Behauptung, dass der Staat ineffizient oder gar schädlich agiere, wird durch zahlreiche wirtschaftliche Krisen und soziale Ungleichheiten immer wieder in Frage gestellt. Eine weitere Annahme des Neoliberalismus betrifft die Betonung der Privatisierung und Deregulierung. Diese Maßnahmen sollen vermeintlich Wettbewerb fördern und die Innovationskraft steigern.
Tatsächlich zeigte sich aber vielfach, dass in vielen Fällen durch Privatisierungen öffentliche Güter und Dienstleistungen verschlechtert wurden. Es entsteht eine Dominanz großer Konzerne, die in einigen Branchen Monopole oder Oligopole bilden, was den Wettbewerb einschränkt und die Konsumenten sowie Arbeitnehmer benachteiligt. Deregulierungen können zudem Risiken für die Finanzmärkte mit sich bringen und Finanzkrisen begünstigen, wie die weltweite Krise von 2008 eindrücklich demonstrierte. Die neoliberale Ideologie propagiert die selbstregulierende Kraft der Märkte und den Abbau sozialer Sicherungssysteme als unerlässlich für wirtschaftliches Wachstum. Dabei wird häufig außer Acht gelassen, dass soziale Stabilität und Chancengleichheit wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung sind.
Die Vernachlässigung sozialer Aspekte führt nicht selten zu wachsender Ungleichheit und gesellschaftlichem Unfrieden, wie sich in zahlreichen Ländern beobachten lässt. Besonders in Zeiten von wirtschaftlichen Schocks oder globalen Herausforderungen wie der Pandemie wird sichtbar, wie sehr strikte neoliberale Konzepte an ihre Grenzen stoßen. Die Rolle des Staates als Garant für soziale Sicherung, Gesundheit und Bildung wird dabei neu bewertet. Auch empirische Studien zeigen, dass reine Marktmechanismen ohne Regulierung und Kontrolle zu Fehlentwicklungen führen können. Der Mythos der vollkommenen Konkurrenz und der rationalen Akteure hat somit bei genauerer Betrachtung wenig mit der Wirklichkeit gemein.
Zudem basiert die neoliberale Theorie auf Annahmen über grenzenloses Wachstum und permanente Expansion der Märkte. Dies kollidiert zunehmend mit begrenzten natürlichen Ressourcen und ökologischen Herausforderungen. Das blinde Vertrauen in die Marktkräfte wird hier zu einem Problem, da Umweltaspekte nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die ökologische Krise erfordert ein Umdenken und die Integration nachhaltiger Prinzipien in wirtschaftliches Handeln, was mit der neoliberalen Ausrichtung oft schwer vereinbar ist. Der Einfluss von Lobbyverbänden und wirtschaftlichen Interessengruppen auf politische Entscheidungen ist ein weiterer Aspekt, der die neoliberale Theorie in der Praxis infrage stellt.
Statt eines fairen Wettbewerbs zwischen Marktteilnehmern dominieren oftmals die Interessen großer Konzerne, die Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren nehmen und ihre Marktmacht sichern. Dies führt zu einer Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen und unterminiert das Ideal einer offenen Marktwirtschaft. Es ist wichtig, die neoliberale Ökonomie nicht als naturgegebenes Dogma zu betrachten, sondern als eine von vielen wirtschaftlichen Theorien, die aufgrund ihrer Annahmen und Praxisfolgen kritisch beäugt werden sollten. Die komplexen Herausforderungen der heutigen Zeit – soziale Ungleichheit, Klimawandel, globale Krisen – erfordern flexible und integrative Ansätze, die sich nicht ausschließlich an neoliberalen Ideen orientieren. Alternative Konzepte wie soziale Marktwirtschaft, nachhaltige Entwicklung und stärkere staatliche Eingriffe rücken daher verstärkt in den Fokus der Wissenschaft und Politik.
![Neoliberal economics is based on assumptions and fantasies [video]](/images/C26BBA6C-8393-4A89-8B2B-43157638F48D)


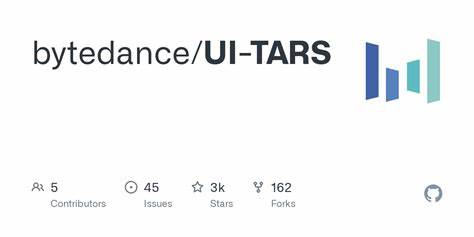
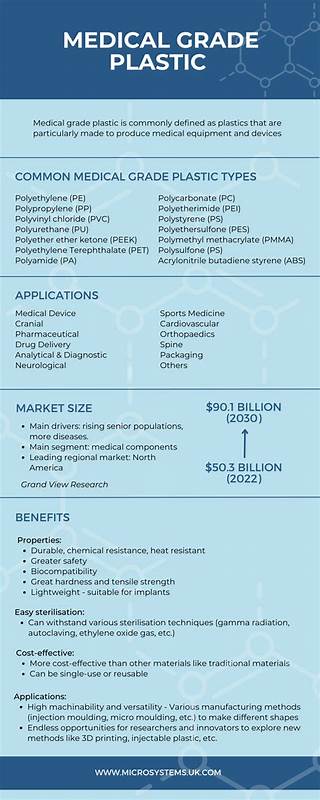
![Implicit UVs: Real-time semi-global parameterization of implicit surfaces [pdf]](/images/090CB859-F55B-457A-ADF1-988138671EBB)