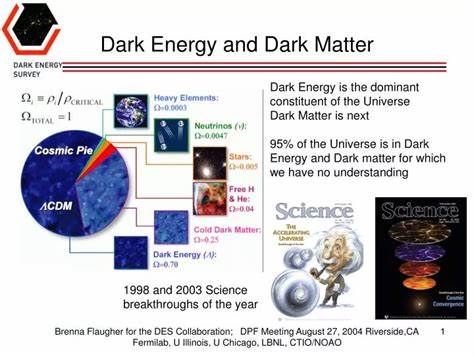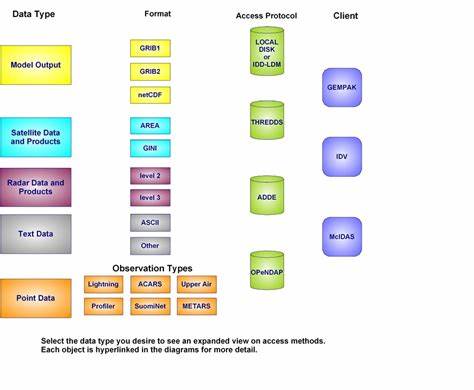Die Vorherrschaft des US-Dollars als Leitwährung der Weltwirtschaft hat über viele Jahrzehnte hinweg das globale Finanzsystem geprägt und beeinflusst. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist der Dollar nicht nur wichtigste Reservewährung für Zentralbanken weltweit, sondern auch das bevorzugte Zahlungsmittel im internationalen Handel. Doch es mehren sich die Anzeichen, dass diese Ära in eine neue Phase eintreten könnte. Wirtschaftsexperten wie Kenneth Rogoff, renommierter Ökonom und ehemaliger Chefvolkswirt des Internationalen Währungsfonds, sehen die Dominanz des US-Dollars vor einem Abstieg – wenngleich er weiterhin eine führende Stellung innehaben wird. Was steckt hinter dieser Entwicklung und welche Veränderung bedeutet dies für die Weltwirtschaft, insbesondere für die USA selbst? Ein genauerer Blick zeigt die komplexen Zusammenhänge, die das mögliche Ende der Dollar-Dominanz umgeben.
Die Geschichte des US-Dollars als Weltwährung ist eng mit der nachkriegszeitlichen globalen Ordnung verbunden. Das Bretton-Woods-System, eingeführt 1944, etablierte den Dollar als zentrale Währung, die bis 1971 durch Gold gedeckt war. Richard Nixon schaffte die Goldbindung dann ab, und seitdem ist der Dollar eine Fiat-Währung, die auf dem Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft basiert. Diese Entwicklung ermöglichte den USA eine außergewöhnliche Wirtschaftsposition und gab ihnen eine enorme politische und finanzielle Macht. Außenpolitisch konnten die USA Dollar-basierte Sanktionen einsetzen, die oft wirksamer waren als militärische Einsätze.
Dennoch brachte der Wechsel weg vom Goldstandard langfristig neue Herausforderungen mit sich. Der wirtschaftshistorische Kontext macht deutlich, dass die Vormacht des US-Dollars keine Selbstverständlichkeit war. Zahlreiche andere Währungen standen über die Jahre im Wettbewerb, darunter damals die Währungen der Sowjetunion, Japans und Europas. Die Sowjetunion galt lange als ernstzunehmender Konkurrent, doch ihre Währung, der Rubel, konnte sich nie gegen die Stärke des Dollars durchsetzen. Auch Japans Wirtschaft wurde als potenzieller Ersatz angepriesen, Wolfspringerpapier Wirtschaftswissenschaftler prognostizierten, sie könne die Vereinigten Staaten einholen.
Doch das gesamtwirtschaftliche Wachstum blieb hinter diesen Erwartungen zurück. Europa versuchte mit der Einführung des Euro eine gemeinsame Währung zu schaffen, die die Rolle des Dollars herausfordern könnte. Doch der Euro erreichte diese Dominanz nie und geriet zudem immer wieder durch Schuldenkrisen ins Wanken. Der US-Dollar hat in den vergangenen Jahren eine leichte, aber stetige Schwächephase durchlaufen. Expertinnen und Experten sehen 2015 als Wendepunkt, von dem an die Übermacht des Dollars begann abzunehmen.
Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Auf innenpolitischer Ebene spielen der steigende US-amerikanische Staatsschuldenberg, der aktuell bei rund 36 Billionen US-Dollar liegt, und die zunehmende Debatte über die Unabhängigkeit der Federal Reserve, der US-Notenbank, eine wesentliche Rolle. Die Zentralbank spielte traditionell eine Schlüsselrolle für das Vertrauen in die Währung, indem sie Zinspolitik und Geldmengenausweitung kontrollierte. Heutzutage wird das Mandat der Fed politisch stärker hinterfragt und teilweise offen angegriffen, was wiederum die Stabilität des Dollars infrage stellen könnte. Die Erfahrung anderer Länder zeigt, dass die Unabhängigkeit von Zentralbanken gerade in Krisenzeiten oder unter Regierungen mit starkem politischem Druck oft eingeschränkt wird.
Extern wachsen die Herausforderungen durch geopolitische Rivalen und wirtschaftliche Blöcke. Besonders China wird als wirtschaftlicher Gigant wahrgenommen, der das Ziel verfolgt, die nationale Währung Renminbi zu internationalisieren und unabhängiger vom Dollar zu machen. Die wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland nach dessen Invasion in der Ukraine haben diesen Willen verstärkt. Viele asiatische Länder suchen nach Wegen, um sich von der Dollarabhängigkeit zu lösen. Parallel entstehen Handelsallianzen, die alternative Währungen und Zahlungssysteme fördern.
Trotz aller Bemühungen sind diese Systeme bislang jedoch nicht in der Lage, die jahrzehntelange Dominanz des US-Dollars vollumfänglich zu ersetzen. Die Bedeutung der Dollar-Dominanz für den Alltag der US-Amerikaner ist oft unterschätzt. Für deutsche Leserinnen und Leser mag dies zunächst überraschend klingen, doch die Unternehmens- und Verbraucherzinsen in den USA sind eng an die weltweite Akzeptanz und Vertrauenswürdigkeit des Dollars gekoppelt. Aufgrund der weltweiten Nachfrage nach US-Staatsanleihen kann die amerikanische Regierung zu relativ niedrigen Zinsen Geld aufnehmen. Wenn diese Zeiten vorbei sind, könnten Zinssätze steigen, was die Kosten für private Haushalte erhöht – sei es für Hypotheken oder andere Kredite.
Für Staat und Wirtschaft würde das ebenfalls Mehrkosten bedeuten, die wiederum in höhere Steuern oder Haushaltskürzungen münden könnten. Krisenzeiten demonstrieren die Vorteile der Dollar-Vormacht besonders deutlich; die USA konnten außergewöhnlich schnell und billig Liquidität bereitstellen, um globale und nationale Krisen wie die Finanzkrise 2008 oder die Pandemie zu bewältigen. Die ironische Wendung der amerikanischen Finanzgeschichte spiegelt sich im Satz des ehemaligen US-Finanzministers John Connally wider, der nach dem Ende der Goldbindung 1971 sagte: „Es ist unser Dollar, aber euer Problem.“ Er meinte die Fremdwährungsreserven anderer Länder, die seitdem an Wert schwanken, weil sie nicht mehr durch Gold gedeckt sind, sondern auf dem Vertrauen in die US-Regierung basieren. Dieser Umstieg hat eine große Verantwortung für die USA geschaffen, denn eine allzu lockere Geldpolitik führt zu Inflation, was wiederum die globale Wirtschaft beeinträchtigt.
Dieses Problem sorgt für Spannungen und darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Kenneth Rogoff betont in seinem Buch „Our Dollar, Your Problem“ die Verantwortung, die mit der Rolle als Weltwährung einhergeht. Gleichzeitig warnt er davor, den Dollar bald durch eine andere Währung ersetzt zu sehen, da bislang kein anderes Land oder Währungsraum sich als ernsthafte Alternative etablieren konnte. Dennoch wird der Dollar in Zukunft weniger einzigartig sein als in der Vergangenheit und mehr Konkurrenz durch den Euro, den Renminbi oder digitale Währungen erfahren. Rogoffs persönliche Erfahrungen als Schachspieler in den kommunistischen Ländern der 1960er und 1970er Jahre geben seiner Analyse eine interessante Perspektive.
Er erkannte früh, dass wirtschaftliche Macht nicht allein von offiziellen Statistiken bestimmt wird, sondern auch von tatsächlicher Produktivität, Infrastruktur und technologischen Fortschritten abhängt. Diese Beobachtungen halfen ihm, die Schwächen von konkurrierenden Wirtschaftssystemen einzuschätzen und deren Chancen als ernstzunehmende Alternativen zum US-Dollars realistischer zu bewerten. Zukunftsweisend ist auch die Rolle digitaler Währungen und Finanztechnologien. Zentralbanken weltweit beschäftigen sich mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), die langfristig das Finanzsystem verändern könnten. Staaten wie China treiben ihre digitale Währung voran, um internationale Transaktionen schneller und weniger abhängig vom US-Finanzsystem zu machen.
Allerdings steht die breitflächige Akzeptanz und Stabilität solcher Systeme noch auf dem Prüfstand. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Zeit des US-Dollars als unangefochtene Nummer eins im globalen Finanzsystem möglicherweise zu Ende geht. Die heutige Situation ähnelt einer „späten Lebensphase“ - der Dollar bleibt dominant, hat aber deutlich an Strahlkraft eingebüßt. Für die USA bedeutet dies erhebliche Herausforderungen, sowohl in der Fiskal- als auch in der Geldpolitik. Für den Rest der Welt eröffnen sich neue Chancen, aber auch Unsicherheiten in der internationalen Zusammenarbeit und im Handel.
Der Übergang zu einem multipolaren Währungssystem liegt in der Zukunft, doch bislang ist kein klarer Nachfolger in Sicht. Unabhängig davon steht fest, dass das Vertrauen, die politische Stabilität und die wirtschaftliche Stärke weiterhin entscheidende Faktoren für die Rolle von Währungen im 21. Jahrhundert sein werden.