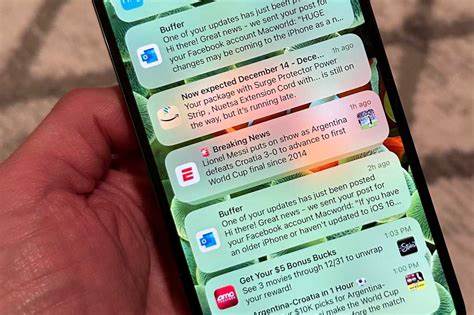Der Flughafen Madrid-Barajas ist nicht nur das Tor Spaniens zur Welt, sondern auch zur unfassbaren Realität einer wachsenden Randgruppe: den obdachlosen Menschen, die dort Nacht für Nacht Zuflucht suchen. Zwischen 300 und 400 Personen verbringen ihre Nächte auf den Böden, in den Ecken und unter den Rolltreppen der Terminals. In Spitzenzeiten sind es sogar bis zu 500 Menschen, die ein Dach vermissen und dennoch keinen anderen Zufluchtsort finden, als das geschäftige Terminal des Flughafens. Diese Tatsache blieb lange im Dunkeln, bis eine religiöse Organisation namens Mesa de la Hospitalidad, zu der auch Caritas gehört, den Mut aufbrachte, eine umfassende Bestandsaufnahme durchzuführen. Die Aufdeckung der Zahlen und der persönlichen Geschichten dieser Menschen hat die Behörden endlich zum Handeln gezwungen, doch bisher bleiben viele Fragen offen.
Die meisten Menschen, die in den Terminals der Barajas übernachten, leiden unter enormen psychischen und physischen Problemen. Viele von ihnen kämpfen mit ernsthaften psychischen Erkrankungen und chronischen Krankheiten, die durch die Straßenlage nur verschlimmert werden. Hinzu kommen Arbeitslosigkeit und fehlende finanzielle Mittel, um sich Unterkünfte leisten zu können oder Zugang zu den selten angebotenen Plätzen in städtischen Notunterkünften zu erhalten. Trotz der Bemühungen einzelner sozialer Organisationen scheint die offizielle Unterstützung der städtischen, regionalen und nationalen Behörden bis heute lückenhaft und unzureichend zu sein. Es gab lange keine präzise Datenlage, was eine koordinierte Hilfe erschwerte und die betroffenen Menschen weiterhin ins Unsichtbare drängte.
In den Terminals berichten mehr als 20 von EL PAÍS befragte Personen von ihrem täglichen Überlebenskampf. Es sind Einheimische aus Madrid ebenso wie Migranten, aber erstaunlicherweise befinden sich unter ihnen kaum Asylsuchende, entgegen den Behauptungen der Stadtverwaltung. Rosa V., eine 67-jährige Frau aus dem Madrider Viertel Vallecas, erzählt von ihrem Absturz in die Obdachlosigkeit nach dem Ende der Winterunterkunftsaktion. Nach einem Beziehungsende und Streitigkeiten mit ihrem Ex-Mann verlor sie jeglichen Schutz.
Die sichtbare Erschöpfung, die in ihrem Gesicht zu lesen ist, macht deutlich, wie stark sich ihr Leben innerhalb weniger Monate verändert hat. Trotz ihrer offensichtlichen Not hat Rosa bisher kaum Kontakte zu den städtischen Sozialarbeitern aufgenommen, die angeblich regelmäßig am Flughafen präsent sein sollten. Ihre Hoffnung auf schnelle und unkomplizierte Hilfe schwindet, denn die bürokratischen Wartezeiten lassen viele obdachlose Menschen verzweifeln und in Vergessenheit geraten. Paulina, eine 60-jährige Peruanerin, schildert eine andere Facette des Problems: Ausbeutung am Arbeitsplatz und der dadurch verursachte Fall ins Bodenlose. Sie arbeitete als Pflegekraft für eine ältere Dame, wurde schlecht bezahlt und schlecht behandelt.
Als sie sich schließlich weigerte, unter diesen Bedingungen weiterzuarbeiten, landete sie auf der Straße und zog zum Flughafen. Dort hat sie seit einem Monat kein Zuhause mehr. Die Hoffnung auf Unterstützung durch die lokalen Behörden bestand nur kurzfristig; die wenigen Tage im städtischen Krisenzentrum endeten mit der Aufforderung, zu gehen. Ältere Menschen haben es auf dem Arbeitsmarkt nach Paulinas Erfahrung deutlich schwerer, eine neue Anstellung zu finden, was die Rückkehr in feste Wohnverhältnisse erschwert. Zwischen den zahlreichen Kirchen und Suppenküchen Madrids sucht sie tagsüber nach Essensangeboten und sozialer Unterstützung.
Teresa Andrade, eine 54-jährige Frau spanisch-ecuadorianischer Herkunft, verlor innerhalb weniger Wochen ihren Job und damit ihre finanzielle Existenz. Trotz langjähriger Arbeit in der Altenpflege verlor sie die Kontrolle über bürokratische Hürden, die ihre Arbeitslosenunterstützung verzögern. Gemeinsam mit ihrem Partner musste sie notgedrungen ihr Mietzimmer aufgeben und fand Zuflucht im Flughafen. Ihre Worte zeigen verzweifelte Resignation: „Ich bin es leid, auf dem Boden zu schlafen“. Sie beschreibt die Atmosphäre am Flughafen als noch belastender als in psychiatrischen Einrichtungen, da viele obdachlose Menschen dort schwere psychische Erkrankungen aufweisen.
Die Verbindung zu einer Sozialarbeiterin in Leganés besteht, doch Aktivitäten der Stadtverwaltung sichtbaren Unterstützung am Flughafen ähneln sich kaum. Auch Marcelo Montoya, ein 19 Jahre in Spanien lebender Chilene, hat seinen festen Platz am Flughafen gefunden. Er berichtet von seinen gesundheitlichen Problemen, darunter sechs vorangegangene Herzinfarkte, die durch die Lebensumstände auf der Straße verschärft werden. Obwohl er dringend medizinische und soziale Unterstützung bräuchte, fühlt er sich von der Verwaltung im Stich gelassen. Wiederholte Versprechen, auf Wartelisten zu kommen, hinterlassen bei ihm den Eindruck von Frustration und unerfüllten Hoffnungen.
Seine Lebensgeschichte steht exemplarisch für viele, die sich trotz katastrophalen Zuständen weigern, aufzugeben. Der politische Umgang mit der Problematik zeigt die Komplexität der Verantwortlichkeiten. So führt der Madrider Bürgermeister José Luis Martínez-Almeida von der konservativen Partei Partido Popular (PP) die Anwesenheit von Antragstellern auf Asyl als Grund an, die Unterstützung für die Flüchtlinge müsse vor allem vom Innenministerium kommen, eine Zuständigkeit der zentralen Regierung. Gleichzeitig gibt die Flughafenbehörde AENA an, der Anteil von Asylsuchenden unter den Obdachlosen sei extrem gering oder nahezu nicht vorhanden. Diese Uneinigkeit erschwert einen gezielten Ausbau von Hilfsangeboten und verschärft die Lage der Betroffenen.
Die langen Wartezeiten in den zuständigen sozialen Einrichtungen, mangelnde Kapazitäten in Notunterkünften und verwirrende bürokratische Abläufe führen dazu, dass viele Obdachlose im Flughafen eine Art unfreiwillige Heimat finden. Der Terminalkomplex, der eigentlich den Reisenden Sicherheit und Komfort bieten soll, wird im Verborgenen zum Rückzugsort für jene, die sonst nirgendwo schlafen können. Viele schlafen auf dem kalten Boden unter improvisierten Decken, isolieren sich in leeren Ecken oder unter Treppen, und arrangieren sich mit einer drastisch heruntergekommenen Lebensrealität. Diese prekäre Situation macht auch deutlich, wie brüchig die soziale Infrastruktur der Stadt Madrid eigentlich ist. Der Mangel an koordinierten Maßnahmen, die nicht nur auf unmittelbare Obdachlosigkeit reagieren, sondern auch präventiv wirken, zeigt Handlungsbedarf auf allen Regierungsebenen.
Es benötigt neben kurzfristigen Unterbringungsmöglichkeiten auch eine langfristig ausgerichtete Strategie, die medizinische Betreuung, psychologische Unterstützung und berufliche Wiedereingliederung umfasst. Gleichzeitig bedarf es eines besseren Austausches und koordinierter Aktivitäten zwischen kommunalen, regionalen und nationalen Behörden sowie den zahlreichen sozialen Organisationen vor Ort. Die Geschichten von Rosa, Paulina, Teresa und Marcelo sind nicht nur bewegende Einzelschicksale, sondern stehen stellvertretend für ein gesellschaftliches Phänomen, das in der Öffentlichkeit bisher kaum wahrgenommen wurde. Während am Flughafen das geschäftige Treiben der Reisenden den Alltag bestimmt, kämpft eine große Zahl von Menschen im Verborgenen gegen die Kälte der Nacht, Einsamkeit und die Zerbrechlichkeit ihrer Existenz. Ihre Stimmen spiegeln die Versäumnisse und die dringenden Anforderungen an eine Gesellschaft wider, die sich um jeden einzelnen Menschen kümmern muss.
Die Anerkennung dieser Realität führte endlich dazu, dass am 13. Mai 2025 ein erster offizieller Bericht der Organisatoren der Zählung vorgestellt wurde. Darin wird sowohl die Anzahl der obdachlosen Menschen am Flughafen präzise benannt, als auch auf deren vielschichtige Bedürfnisse hingewiesen. Diese Daten bilden die Grundlage, um neue Lösungsansätze zu entwickeln und die vorhandenen Hilfsstrukturen zu verbessern. Es bleibt zu hoffen, dass die kommenden Monate von einer verstärkten politischen und gesellschaftlichen Aufmerksamkeit geprägt sein werden, die zu praktikablen und menschenwürdigen Lösungen führt.
Madrid-Barajas ist ein Symbol für Austausch, Bewegung und Offenheit. Es wäre ein grundlegendes Zeichen gesellschaftlicher Solidarität, wenn es gleichzeitig zum Ort für den Schutz und die Unterstützung der Schwächsten in der Stadt würde. Die Geschichten und Berichte der obdachlosen Menschen am Flughafen mahnen dazu, den Blick auf diese verborgene Wirklichkeit nicht abzuwenden und gemeinsam an einer Stadt zu arbeiten, die für alle da ist.