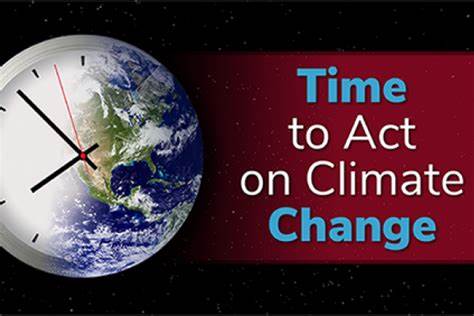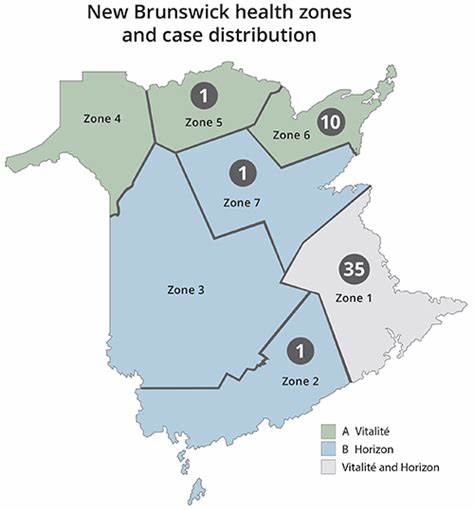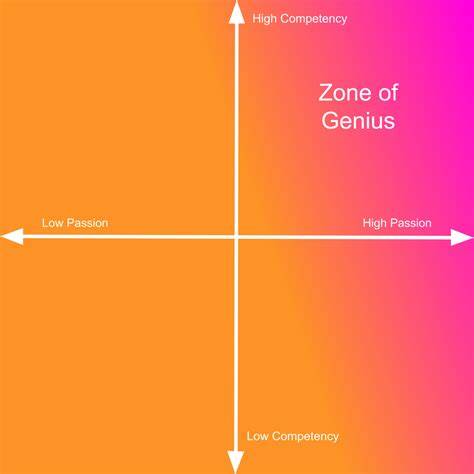Im digitalen Zeitalter, in dem große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) und Künstliche Intelligenzen allgegenwärtig sind, wird eine zentrale Frage immer dringlicher: Verstehen wir überhaupt noch, was wir erschaffen? Die Antwort darauf spiegelt sich in einem philosophischen Konzept, das bereits vor über 300 Jahren formuliert wurde, aber heute aktueller ist denn je – die sogenannte Makers Knowledge, hervorgegangen aus der Philosophie Giambattista Vicos. Seine zentrale Einsicht lässt sich mit dem lateinischen Spruch „Verum factum“ zusammenfassen, der besagt, dass wahres Wissen nur durch eigenes Machen entsteht. Gerade in einer Ära, in der algorithmische Systeme Wege beschreiten, die wir nicht umfassend nachvollziehen können, stellt diese Idee eine grundlegende Kritik und zugleich einen Handlungsaufruf dar: Wenn wir nicht selbst machen, verstehen wir nichts wirklich. Giambattista Vico, ein italienischer Philosoph aus dem 18. Jahrhundert, vertrat die Ansicht, dass echtes Wissen nicht bloß durch das Studium oder das bloße Lesen zu erlangen ist.
Er forderte, dass wir erst durch das körperliche und geistige Schaffen eines Objektes oder eines Gedankens dessen Wesen vollständig erfassen können. Wer verstehen will, wie Brot entsteht, sollte selbst backen. Wer die Mechanik eines Fahrrads durchschauen möchte, muss es selbst zusammenbauen. Dies gilt nicht nur für handwerkliche Dinge, sondern ebenso für abstrakte Konzepte wie Philosophie – echte Philosophie entsteht durch eigenes Denken und Gestalten, nicht nur durch das Lesen von Büchern. Diese Verbindung von Denken und Machen ist für den heutigen Design- und Entwicklungsprozess ein unerschöpflicher Schatz.
In modernen Berufsfeldern, die sich mit Gestaltung und Technologie beschäftigen, lässt sich häufig beobachten, dass erfahrene Praktiker intuitiv nach dem Prinzip der Makers Knowledge arbeiten, auch wenn es ihnen nicht immer bewusst ist. Das Aneignen von Wissen durch Tun fördert ein tieferes Verständnis und eine intensivere Beziehung zu dem Produkt, das entsteht. Dies schlägt sich in besserer Qualität, kreativer Innovationsfreude und einem ganzheitlicheren Zugang zu Problemlösungen nieder. Doch warum ist dieses Prinzip trotz seiner scheinbaren Selbstverständlichkeit nicht breiter anerkannt? Ein wesentlicher Grund liegt in der tief verwurzelten Trennung von Theorie und Praxis, wie sie sich in der westlichen Bildung und Philosophiegeschichte manifestiert hat. Seit der Antike wird Handarbeit und körperliches Tun gegenüber der contemplativen Philosophie und abstrakten Vernunft vernachlässigt.
Bei Platon etwa stand die ewige Welt der Formen über dem Wandelbaren der materiellen Welt – eine Hierarchie, die das rein Geistige über das Praktische stellte und damit die manuelle Arbeit abwertete. Diese Trennung setzte sich über die Jahrhunderte fort und führte zu einem Bildungssystem, das vom Sitzenbleiben, Zuhören und Auswendiglernen geprägt ist und das praktische, intellektuelle Begreifen durch eigenes Erschaffen vernachlässigt. Gerade in Schulen zeigt sich diese Diskrepanz besonders deutlich. Kinder verbringen viele Jahre damit, theoretisches Wissen passiv aufzunehmen, ohne dass ihnen genügend Gelegenheit gegeben wird, dieses Wissen durch eigenes Machen zu verfestigen. Diese Trennung wird später im Berufsleben oft in unüberwindbare Grenzen von Theorie und Praxis transformiert, die das volle Potenzial von Kreativität und Verständnis limitieren.
Das Wissen, das wir heute mit Hilfe von LLMs und Künstlichen Intelligenzen zu generieren versuchen, befindet sich auf einer seltsamen Ebene. Solche Systeme erzeugen große Mengen an Informationen und können komplexe Zusammenhänge simulieren, doch dieses Wissen entzieht sich oft dem direkten Verstehensprozess. Die Algorithmen hinter diesen Modellen basieren auf statistischer Analyse und Mustererkennung, haben aber kein eigenes Verständnis im menschlichen Sinne. Das erzeugte Wissen bleibt abstrakt und fremd, wenn wir nicht selbst aktiv werden und es durch eigene Erfahrung und Schöpfung in eine für uns nachvollziehbare Form bringen. Die Makers Knowledge fordert daher eine Rückkehr zu einem Prinzip, das nicht nur digitalen Tools, sondern auch der Bildungslandschaft und der Philosophie neuen Schwung verleihen kann.
Dieses Prinzip betont, dass Denken kein isolierter Vorgang sein darf und dass Wissen und Verständnis erst in der Verbindung von Handwerk und Kopf entstehen. Im Bereich des Designs ist dies besonders evident: Eine gute Gestaltung ist nur möglich, wenn der Gestalter das Produkt auch wirklich „begreift“ – nicht nur intellektuell, sondern auch physisch und sinnlich. Design, das sich der Makers Knowledge verpflichtet, arbeitet mit den vier Ursachen, wie sie bereits Aristoteles beschrieben hat: Material, Form, Ursache und Zweck. Wer etwas gestaltet, muss sich bewusst mit dem Stoff auseinandersetzen, aus dem es besteht, mit der Form, die es annimmt, mit der Ursache seiner Herstellung und dem Zweck, den es erfüllen soll. Dieses Denken in ganzheitlichen Zusammenhängen stärkt nicht nur die Qualität der Arbeit, sondern auch das Verständnis für die eigenen Schöpfungen.
Für Philosophen hingegen bedeutet die Rückbesinnung auf Makers Knowledge eine Einladung, die bisherige Trennung von Theorie und Praxis zu überwinden und selbst mehr zu gestalten – sei es durch handwerkliche Tätigkeiten, künstlerische Schöpfungen oder experimentelle Methoden. Philosophische Konzepte sollten nicht nur in Texten existieren, sondern sich auch durch Form, Struktur und Material manifestieren, um für ein größeres Publikum zugänglich und verständlich zu werden. Philosophie könnte so lebendiger, wirksamer und nachvollziehbarer werden. Die Vermischung von Design und Philosophie zeigt, dass Lernen und Verstehen eine aktive, körperliche Angelegenheit sind. Wenn wir nicht selbst machen, bleiben wir auf der Oberfläche des Wissens gefangen.
Das gilt umso mehr im Zeitalter der LLMs, deren Vorteile zwar unverkennbar sind, deren Entwicklung und Funktionsweise aber für viele Nutzer eine Blackbox bleiben. Um die Chancen, die Künstliche Intelligenz bietet, voll auszuschöpfen, braucht es deshalb eine Kultur des aktiven Mitgestaltens – eine Welt, in der Entwickler, Designer und Philosophen nicht nur Nutzer sind, sondern Macher und Erschaffer. Nur so lässt sich verhindern, dass wir uns in einer Welt verlieren, in der wir die Produkte unserer eigenen Kreativität nicht mehr verstehen. Zudem eröffnet Makers Knowledge neue Perspektiven für die Zukunft der Bildung. Praxisorientierte Lernansätze könnten junge Menschen motivieren und ihnen eine tiefere Verbindung zu ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten ermöglichen.
Das frühzeitige Verschmelzen von Denken und Handeln könnte die Grundlage für eine Kultur der Innovationsfähigkeit, des kritischen Denkens und der Bewusstheit bilden – etwas, das in Zeiten von Automatisierung und digitaler Transformation unverzichtbar ist. Die Herausforderung liegt somit darin, das uralte Wissen um die Makers Knowledge mit den modernen Entwicklungen zu verbinden. Es geht nicht darum, die neuen Technologien abzulehnen, sondern ihnen mit einer Haltung zu begegnen, die das eigene Verstehen fordert. Eine Welt, in der wir weder Diktate von Maschinen akzeptieren noch in reiner Theorie verharren, sondern aktiv gestalten, testen und reflektieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Makers Knowledge gerade im Kontext der aktuellen technologischen Umbrüche eine wertvolle Orientierungshilfe sein kann.
Sie erinnert uns daran, dass Lernen ein lebendiger Prozess ist, der den ganzen Menschen beansprucht – Kopf, Hände und Herz. Indem wir selbst machen, verstehen wir mehr, werden reflektierter und schaffen Werke, die nicht nur funktionieren, sondern auch Bedeutung entfalten. Im Zusammenspiel von Philosophie und Design, von Theorie und Praxis, von Denken und Tun liegt das Potenzial, unser Verständnis von Wissen grundlegend zu erneuern – in einer Welt, die trotz aller Digitalisierung nicht den Kontakt zur eigenen Kreativität verlieren darf.