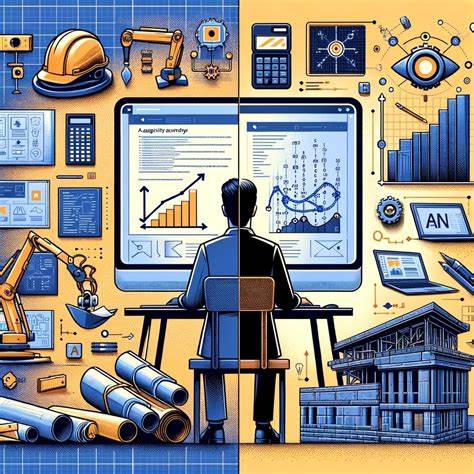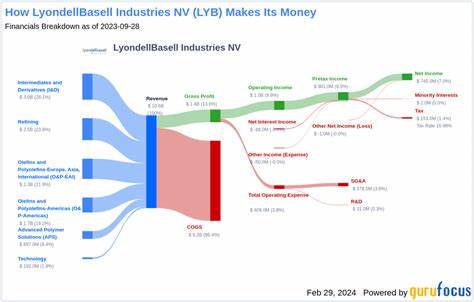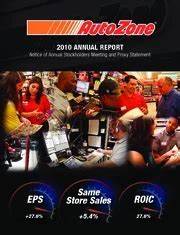Die Finanzwelt steht angesichts eines neuen Vorstoßes aus Washington vor erheblichen Herausforderungen. Das in der US-Repräsentantenkammer verabschiedete Gesetz, bekannt als „One Big Beautiful Bill Act“, enthält mit der umstrittenen Section 899 die tiefgreifendsten Änderungen in der Behandlung ausländischen Kapitals auf dem US-Markt seit Jahrzehnten. Während der Gesetzesentwurf noch auf die Zustimmung des Senats wartet, wächst die Sorge bei Investoren, Banken und Unternehmensberatern, dass die neue Steuerregelung den internationalen Kapitalverkehr stark beeinträchtigen dürfte. Section 899 zielt darauf ab, Investoren aus sogenannten „diskriminierenden ausländischen Ländern“ zu treffen, also Staaten, die US-Firmen mit speziellen Steuern, wie der Digital Services Tax (DST), belegen und somit als Handelshemmnis angesehen werden. Frankreich und Deutschland sind prominente Beispiele für solche Länder.
Frankreich erhebt bereits eine 3-prozentige Steuer auf Umsätze von Onlineplattformen, die vor allem Silicon-Valley-Giganten wie Google, Amazon, Facebook und Apple trifft. Deutschland zieht ähnlich gelagerte Steuern nach. Die US-Regierung möchte mit dem neuen Gesetz die steuerlichen Nachteile für amerikanische Unternehmen wieder ausgleichen. Im Kern erhöht sich die Steuerlast auf US-Einkünfte ausländischer Investoren aus den betroffenen Ländern jährlich um fünf Prozentpunkte, maximal jedoch bis zu 20 Prozent, zusätzlich zu bestehenden Steuersätzen. Für ausländische Investoren bedeutet dies eine signifikante Verteuerung ihrer Investitionen in den USA, was zu einer Neubewertung von US-Vermögenswerten und Anleihen führen könnte.
Die Auswirkungen sind besonders in Zeiten globaler Wirtschaftsunsicherheit und überhöhter Defizite heikel. Der Chef der FX-Forschung bei der Deutschen Bank, George Saravelos, warnt vor einer möglichen Eskalation der Handelsspannungen in eine Kapitalauseinandersetzung. Die „Waffnung“ des US-Kapitalmarkts durch steuerliche Maßnahmen könnte die bisher offene Natur der amerikanischen Finanzmärkte grundlegend verändern und gegnerischen Ländern erhebliche Steuerrisiken auferlegen. Ein weiteres zentrales Problem stellt die Einbeziehung staatlicher Investoren und Zentralbanken dar, die in großem Umfang US-Staatsanleihen halten. Frankreich und Deutschland besitzen gemeinsam US-Hedgefonds mit einem Volumen von ungefähr 475 Milliarden US-Dollar.
Aufgrund der höheren Steuerbelastung könnten die Renditen aus diesen Anlagen deutlich sinken, was die Attraktivität von US-Staatsanleihen reduziert und die Finanzierung des US-Haushaltsdefizits erschwert. Analysten bei Barclays heben zudem hervor, dass europäische Unternehmen, die in den USA tätig sind, durch die Gesetzesänderung beeinträchtigt werden könnten. Besonders betroffen sind Firmen, die enge Umsatzbeziehungen mit den USA pflegen – beispielsweise das in London gelistete Compass Group mit Cateringdiensten an amerikanischen Schulen oder InterContinental Hotels mit zahlreichem Immobilienbesitz in den Vereinigten Staaten. Die Aussicht auf Kapitalabflüsse wird daher als realistische Gefahr angesehen, sofern das Gesetz in der aktuellen Form tatsächlich verabschiedet wird. Die ökonomischen Folgen könnten damit über den US-Markt hinausgreifen und das Vertrauen in den US-Dollar als sichere Anlage schwächen.
Diese Entwicklung provoziert eine Neubewertung von Anlageportfolios internationaler Investoren. Investoren aus Ländern, deren Regierungen Digital Services Taxes oder die neue OECD-Unterbesteuerungsregel (UTPR) umsetzen, sehen sich vor erhöhten Steuern geschützt durch Section 899 zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. Große internationale institutionelle Anleger wie australische Pensionsfonds reagieren besorgt auf das Gesetz, da auch Australien mit Arzneimittelzuschusseinschränkungen Konflikte mit der US-Pharmaindustrie pflegt. Die rechtliche Seite des Gesetzes birgt zudem Unsicherheiten. Experten renommierter Kanzleien wie Mayer Brown weisen darauf hin, dass es im weiteren parlamentarischen Prozess im Senat womöglich noch wesentliche Änderungen geben könne.
Insbesondere wird hinterfragt, ob Teilen des Gesetzes, die bestehende Doppelbesteuerungsabkommen außer Kraft setzen könnten, in der endgültigen Fassung Bestand haben. Insgesamt veranschaulicht das Vorhaben den eingeschlagenen Kurs der US-Administration, eine direkte Verbindung zwischen Handelspolitik und Steuergesetzgebung herzustellen. Während Zollstreitigkeiten häufig im Fokus stehen, zeigt sich mit Section 899 eine Steuerwaffe als neues politisches Instrument, die gezielt Druck auf ausländische Staaten und Investoren ausüben kann. Diese Entwicklung verstärkt Unsicherheiten an den Finanzmärkten, die ohnehin durch makroökonomische Herausforderungen und geopolitische Spannungen belastet sind. Die Auswirkungen werden von der Wall Street mit großer Skepsis beobachtet.
Das Anstiegspotenzial der Steuerbelastung auf bis zu 20 Prozent auf US-Finanzanlagen aus bestimmten Ländern trägt zu einer Verteuerung der Investitionskosten bei und könnte Kapitalströme umleiten. In Zeiten, in denen ein offener und global vernetzter Kapitalmarkt als Fundament für wirtschaftliches Wachstum gilt, stellt dies ein erhebliches Risiko für die US-Finanzmarktstellung dar. Überdies wirkt sich die Gesetzesinitiative auf die Attraktivität des US-Dollars als Reservewährung aus. Investoren bevorzugen möglicherweise sichere Anlagen in europäischen Staatsanleihen, wie den deutschen Bundesanleihen, was zu einer Verschiebung in der globalen Kapitalallokation führt. Der Zusammenfluss von Handelspolitik, Steuerrecht und Finanzmarktregulierung verschärft somit bereits bestehende Unsicherheiten und kann zu längerfristigen Verschiebungen in der internationalen Wirtschaft beitragen.
Während die politische Verantwortungsträger der US-Regierung die Gesetzesänderung als notwendigen Schritt zum Schutz amerikanischer Interessen darstellen, wächst der internationale Widerstand und die Sorge um die Prinzipien offener Kapitalmärkte. Die kommenden Monate werden zeigen, wie der Senat auf die kritischen Stimmen reagiert und ob der Gesetzesentwurf substanziell angepasst wird. Bis dahin bleibt die Finanzwelt in erhöhter Wachsamkeit und die Märkte mit erhöhter Volatilität konfrontiert. Die Debatte um das neue US-Steuergesetz zeigt exemplarisch, wie eng vernetzt Handelspolitik und Finanzmarktstabilität heute sind und wie politische Entscheidungen weitreichende wirtschaftliche Verwerfungen auslösen können.