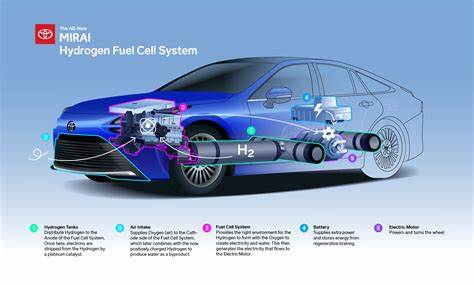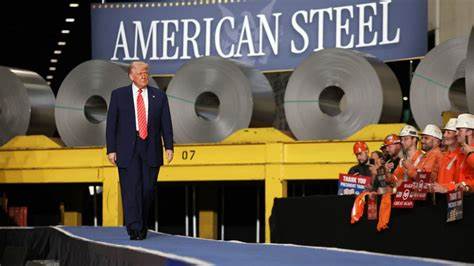Im europäischen Raum vollzieht sich eine bemerkenswerte Veränderung in der IT-Landschaft der öffentlichen Verwaltungen. Jüngst hat das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein mitgeteilt, es werde alle Microsoft-Produkte in staatlichen Institutionen zugunsten von Linux und Open-Source-Software ersetzen. Diese Entscheidung ist Teil eines größeren Trends, der sich zunehmend in der europäischen Politik und Verwaltung abzeichnet: die Abkehr von US-amerikanischen Software-Giganten hin zu offenen, transparenten und eigenständigen IT-Lösungen. Doch was steckt genau hinter diesem Schritt, welche Auswirkungen sind zu erwarten und warum scheint Linux als Alternative immer attraktiver zu werden? Die Antwort findet sich im Streben nach digitaler Souveränität, mehr Sicherheit und Kostenersparnis – ergänzt durch nachhaltige politische und technologische Überlegungen. Der digitale Wandel in der Verwaltung muss heute mehr denn je die Kontrolle über Daten und Systeme garantieren.
Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter begründete die geplante Umstellung mit der fehlenden Einflussnahme auf proprietäre Softwareprozesse und der Sorge vor einem möglichen Datenabfluss in Drittstaaten. Gerade in Zeiten geopolitischer Spannungen – verschärft durch den Krieg in der Ukraine – wird der Blick auf die digitale Abhängigkeit von externen Anbietern als riskant eingeschätzt. Für ein souveränes Verwaltungshandeln sei es unabdingbar, dass der Staat die Kontrolle über im Einsatz befindliche IT-Lösungen behalte und selbstständig agieren könne. Diese Zielsetzung spiegelt sich im Wechsel zu gehörig an: Mit Linux und Open-Source-Programmen kann der Staat individuelle Anpassungen vornehmen, Sicherheitsaspekte transparenter gestalten und die Infrastruktur innerhalb nationaler oder europäischer Grenzen betreiben. Auch die Verlagerung der Daten aus der Microsoft-Cloud Azure hin zu europäischen Cloud-Anbietern spielt hierbei eine zentrale Rolle.
So bleiben Datenhoheit und der Schutz sensibler Informationen besser gewährleistet, was gerade bei Bürgerdaten und sicherheitsrelevanten Informationen essentiell ist. Dass diese Umstellung für rund 30.000 Beschäftigte – darunter Beamte, Polizisten und Richter – erfolgt, zeigt die Dimension dieses Vorhabens. Damit einhergehend ist eine schrittweise Ablösung der Microsoft-Anwendungen: Textverarbeitung und Tabellenkalkulation werden künftig von LibreOffice übernommen, während Open-Xchange und Thunderbird die Funktionen von Exchange und Outlook ersetzen sollen. Für das Betriebssystem wird Linux mit der Desktop-Oberfläche KDE Plasma favorisiert, wobei Varianten wie Kubuntu, SUSE Linux Enterprise Desktop oder openSUSE Leap mögliche Optionen sind.
Zusätzlich werden Open-Source-Tools wie Nextcloud für Kollaboration eingesetzt. Finanziell verspricht sich das Land erhebliche Einsparungen. Lizenzkosten für Microsoft-Software und die Kosten für große Versions-Upgrades, beispielsweise von Windows 10 auf Windows 11, entfallen. Da die EU und ihre Mitgliedstaaten zunehmend auf die Unabhängigkeit von US-amerikanischen Technologiekonzernen setzen, dürfte Schleswig-Holsteins Beispiel nicht das letzte bleiben. Bereits zuvor hatten dänische Behörden einen ähnlichen Schritt mit der Umstellung auf LibreOffice und Linux bekanntgegeben.
Damit positionieren sich diese Staaten als Vorreiter im Kampf für eine europäische digitale Zukunft mit mehr Selbstbestimmung. Die Skepsis gegenüber Microsoft und Co. gründet auch auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. München etwa hatte bereits im Jahr 2004 den Versuch gestartet, mit der Linux-Distribution LiMux den Wechsel von Windows einzuleiten. Obwohl das Projekt letztlich nach einer Dekade mit einer Rückkehr zu Microsoft endete, bleibt LibeOffice dort und anderen Open-Source-Anwendungen ein fester Bestandteil.
Andererseits zeigen erfolgreiche Beispiele wie die französische Gendarmerie, dass ein langfristiger und gut betreuter Linux-Einsatz in großen Behörden möglich ist. Der dortige Einsatz der maßgeschneiderten Ubuntu-Version, GendBuntu, hat sich bewährt und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Das Alles macht klar: Der Schritt von Schleswig-Holstein ist mehr als ein reiner Softwarewechsel. Er steht symbolisch für Europas Wunsch nach einer gestärkten digitalen Souveränität, einer geringeren Abhängigkeit von außereuropäischen IT-Monopolyspielern und einem Fokus auf sichere, kosteneffiziente und nachhaltige IT-Infrastrukturen. Die Vorteile von Open-Source-Software liegen gerade im transparenten Quellcode, der eigenständigen Anpassbarkeit und der Möglichkeit, Gemeinschaften und Entwickler aus ganz Europa einzubinden.
So fördert diese Strategie nicht nur technologische Innovation, sondern stärkt auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit und den Schutz vor politischen Risiken. Die Migration auf Linux verlangt zwar eine sorgfältige Planung, intensive Schulungen und eine begleitende Supportstruktur, doch der Nutzen überwiegt in vielerlei Hinsicht die anfänglichen Herausforderungen. Die Umstellung fördert zudem Zukunftsfähigkeit und Flexibilität im Umgang mit der digitalen Verwaltung, was in einer immer stärker vernetzten Welt unabdingbar ist. Insgesamt zeigt das Beispiel Schleswig-Holstein, wie sich europäische Institutionen entschlossen auf den Weg zu mehr Eigenverantwortung und Sicherheit in der IT machen. Dieser Trend hat das Potenzial, weitere Länder zu inspirieren, proprietäre Zugänge zu hinterfragen und neue Wege in der öffentlichen Verwaltung zu gehen.
Die Zukunft gehört denjenigen, die sich aus Abhängigkeiten lösen und stattdessen auf offene, gemeinschaftlich entwickelte Lösungen setzen – mit dem Ziel, digitale Innovation sicher, transparent und souverän zu gestalten.