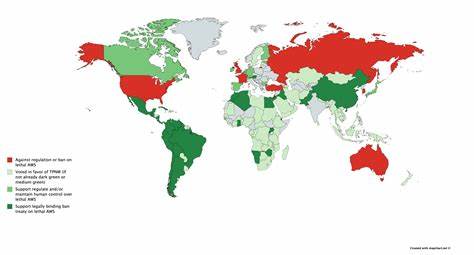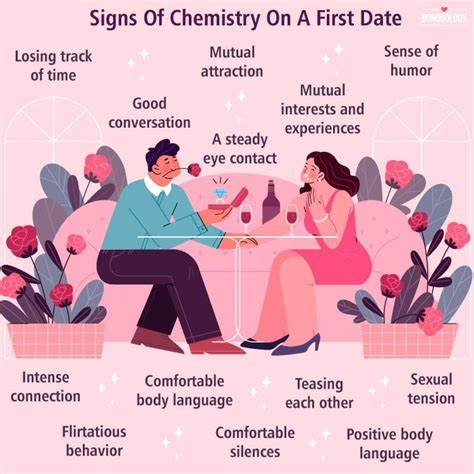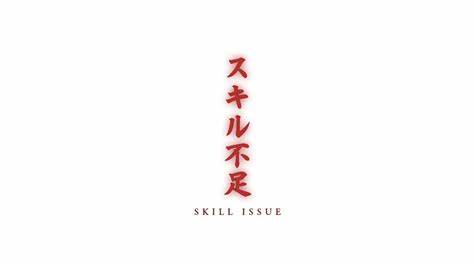Die Vorhersage von viralen Beiträgen im Internet ist seit Jahren eine der größten Herausforderungen für Marketer, Redakteure und Analysten zugleich. Im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, dieses komplexe Phänomen zu erforschen. Michael Taylor, ein erfahrener Prompt Engineer, hat sich dieser Aufgabe gewidmet und ein spannendes Experiment durchgeführt: Er klonte fast 2.000 Nutzer von Hacker News, um herauszufinden, ob künstliche Intelligenz vorhersagen kann, welche Beiträge viral gehen werden. Das Ergebnis zeigt sowohl großes Potenzial als auch fundamentale Grenzen bei der Nutzung von KI für Marktforschung und Social-Media-Analysen.
Hacker News ist eine der beliebtesten Plattformen für Technik- und Startup-affine Menschen, die täglich Tausende von Beiträgen kommentieren und bewerten. Die Entscheidung, welche Storys besonders viele Aufrufe und Upvotes erhalten, spiegelt meist eine komplexe Mischung aus Inhalt, Timing, Community-Präferenzen und sozialen Dynamiken wider. Michael Taylor sammelte hierzu Daten von 1.147 Headlines, die an einem einzigen Tag auf Hacker News erschienen sind, sowie die Kommentare von nahezu 2.000 Nutzern, um daraus virtuelle Personas mit KI zu generieren.
Diese Personas sollten darüber urteilen, welche Beiträge ein großes Publikum erreichen würden. Das spannende Ergebnis: Die KI-Personas erreichten eine Vorhersagegenauigkeit von etwa 60 Prozent. Obwohl dies nicht perfekt ist, liegt die Genauigkeit damit deutlich über Zufall und kann tatsächlich für Marktforschungszwecke relevant sein. Wettbewerber im Bereich KI-Marktforschung verlangen oft mindestens 70 Prozent Übereinstimmung mit menschlichen Urteilen, um als brauchbar zu gelten. Mit 60 Prozent nähern sich virtuelle Nutzer dieser Schwelle an.
Dennoch zeigte die Untersuchung auch, dass es schwierig sein wird, ein deutlich effizienteres Modell zu entwickeln, da virale Phänomene stark von unberechenbaren sozialen Faktoren abhängen. Ein interessanter Aspekt der Studie sind die Fälle, in denen die KI falsch lag. So wurde beispielsweise ein Beitrag zu „Gemma 3“, Googles neuem multimodalen Modell, von den virtuellen Personas als potenzieller Hit eingestuft, erhielt in Wirklichkeit aber nur wenige Upvotes. Ein nahezu identischer Beitrag mit einem minimal veränderten Titel hingegen erzielte eine überwältigende Zustimmung von über 1.300 Stimmen.
Diese Diskrepanz zeigt die enorme Bedeutung von Timing und der sogenannten Social-Momentum-Effekte. Sobald ein Beitrag in den frühen Phasen wenige Upvotes bekommt, wächst die Sichtbarkeit exponentiell und zieht weitere Klicks und Stimmen nach sich – ein Phänomen, das oft als „rich get richer“-Effekt bezeichnet wird. Die Studie erinnert dabei an eine bekannte Untersuchung der Princeton University, bei der tausende Menschen ähnliche Song-Listen hörten. Dort zeigte sich, dass die Sichtbarkeit und die anfänglichen Präferenzen anderer Teilnehmer einen dramatischen Einfluss auf den Erfolg eines Songs hatten. Trotz objektiv gleicher Qualität wurde häufig derselbe Song in unterschiedlichen Gruppen konträr bewertet – teils ein großer Hit, andernorts ein Flop.
Damit wird deutlich, dass der Erfolg und seine Vorhersage von extrem vielen Faktoren geprägt sind, die kaum vollständig automatisiert oder idealerweise simuliert werden können. Für Unternehmen und Marketer hat die Erkenntnis aus Taylors Experiment eine wichtige Bedeutung: KI-gestützte Marktforschung sollte nicht als Entscheidungsinstanz für finale Entscheidungen dienen, sondern vor allem als Werkzeug zur Iteration verwendet werden. Die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit mit vielen unterschiedlichen, virtuell simulierten Personas verschiedene Varianten eines Headlines oder Inhalts zu testen, kann helfen, potenzielle Schwächen zu eliminieren und erfolgreichere Ansätze zu identifizieren. Sobald eine kleinere Auswahl an Kandidaten feststeht, können diese dann gezielt in der realen Community überprüft werden. Der Einsatz mehrerer Simulationen bietet eine weitere Strategie, um die Unsicherheiten zu reduzieren.
Wenn eine Idee beispielsweise bei nur einer von acht Simulationen Erfolg hat, kann man eher von Zufall ausgehen. Trifft sie jedoch in sechs oder mehr Runs gute Ergebnisse, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein tatsächlich vielversprechendes Konzept handelt. Mit sinkenden Kosten und steigender Leistungsfähigkeit von großen Sprachmodellen wird diese Herangehensweise in Zukunft immer praktikabler werden. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass KI besonders gut darin ist, Beiträge klar zu unterscheiden – also offensichtliche Gewinner von eindeutigen Verlierern. Die Herausforderung besteht jedoch meist darin, aus vielen guten Beiträgen den einen großen Hit zu selektieren.
Hier sind Algorithmen und KI zurzeit noch weniger zuverlässig, da feine Nuancen, Stimmungen in der Community und unkontrollierbare externe Einflüsse Faktoren sind, die auch für Menschen schwer greifbar sind. Ein wichtiger Teil des Experiments war die Erstellung der Nutzerpersonas. Dazu wurden öffentliche Kommentare der echten Hacker News Nutzer gesammelt und mit KI-gestützten Methoden analysiert. Dadurch entstanden „virtuelle Menschen“ mit eigenen Profilen, Hintergrundgeschichten und Einschätzungen, die auf den realen Verhaltensmustern basierten. Interessant ist, dass die KI an einigen Stellen kreative Ergänzungen vornahm, wie fiktive Namen oder Lebensgeschichten – stets jedoch auf Basis plausibler Annahmen, die zu den Kommentaren passten.
Solche simulierten Charaktere bieten damit einen neuen Zugang zur qualitativen Marktforschung, auch wenn sie natürlich niemals den echten Menschen gleichen oder ersetzen können. Eine Vorlage für eigene Experimente wird von Michael Taylor ebenfalls bereitgestellt. Wer selbst herausfinden will, wie die Reaktionen von bestimmten Community-Mitgliedern auf neue Ideen oder Headlines ausfallen könnten, kann die Kommentare eines Nutzers kopieren und in ChatGPT oder Claude einfügen. Das KI-Tool erstellt dann eine entsprechende Persona, die später in simulierten Marktforschungsdialogen befragt werden kann. So wird die traditionelle Fokusgruppe ins Digitale verlagert und potenziell skalierbar.
Während das Experiment Hoffnung macht, zeigt es auch die Grenzen der KI bei der Simulation von gesellschaftlichen und sozialen Interaktionen auf. Viraler Erfolg basiert zu einem großen Teil auf nicht-linearen, komplexen Wechselwirkungen zwischen zahlreichen Akteuren und Ereignissen. Diese sozialen Dynamiken erzeugen einen Grad an Zufälligkeit, den bisher keine Technologie vollständig vorhersagen kann. Damit bleibt das Modell der klassischen KI-Marktforschung eine wertvolle Ergänzung, aber nicht der alleinige „Heilige Gral“ für Marketer. Gleichzeitig öffnet das Experiment die Türen zu einem tieferen Verständnis des Verhaltens digitaler Communities und den Einfluss von Sprache, Themenwahl und Timing auf die Viralität.
Indem Unternehmen und Einzelentscheider KI-gestützte Personas einsetzen, können sie ihr Verständnis erweitern und datengetriebener arbeiten – auch ohne teure, langwierige Marktforschungsteams. Insgesamt zeigt sich, dass eine Kombination aus menschlicher Intuition, sozialem Feingefühl und KI-unterstützter Analyse die zukünftige Strategie bei der Entwicklung viraler Inhalte sein wird. Die einfache Vorhersage von Erfolg allein durch Algorithmen bleibt vorerst Wunschtraum, aber der Schritt zur besseren, schnelleren und großflächigeren Forschung ist damit geschafft. Michael Taylor ist mit seinem Experiment ein wichtiges Beispiel gelungen, wie künstliche Intelligenz und Simulationstechnologien in der Realität Anwendung finden können, selbst wenn sie noch nicht perfekt sind. Für die Marketingbranche, Content Creator und Forscher ist die Methode spannend und praxisnah zugleich.
Und mit den weiter sinkenden Kosten von Sprachmodellen und der Verbesserung ihrer Fähigkeiten wird diese Art der virtuellen Marktforschung in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Auch wenn soziale Dynamiken niemals vollständig beherrschbar sind, stellt die Kombination aus KI-Personas und realen Nutzerinformationen einen wertvollen Fortschritt im Umgang mit der digitalen Viralität dar. Wer frühzeitig auf solche Tools setzt, gewinnt einen Vorsprung, sei es bei der Produktauswahl, der Themenfokussierung oder der Optimierung von Headlines. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Technologie weiterentwickelt, aber aktuelle Erfolge zeigen: Die digitale Zukunft der Marktforschung wird geprägt sein von einer engen Verzahnung zwischen Mensch und Maschine.