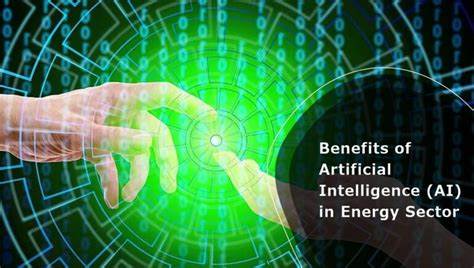Nate Silver, der als einer der bedeutendsten Wahlvorhersager Amerikas gilt, hat mit seinem neuen Buch "On the Edge: The Art of Risking Everything" die Herzen vieler Leser erobert. Doch während sein erstes Werk, "The Signal and the Noise", ein tiefgreifendes Verständnis dafür vermittelte, wie manche Menschen erfolgreicher darin sind, zukünftige Ereignisse vorherzusagen, scheint sein aktuelles Buch einen anderen Weg einzuschlagen. Kritiker wie Dave Karpf warnen davor, dass Silver in die falschen Wetten investiert und damit ein gefährliches Bild von Risiko und Glücksspiel propagiert. Silver, der 2012 mit "The Signal and the Noise" seinen Höhepunkt erreichte, hat sich anscheinend von der Welt der Journalisten und Akademiker entfernt und sich stattdessen den Risikofreudigen und Unternehmern in Las Vegas, Wall Street und Silicon Valley zugewandt. In "On the Edge" scheint Silver eine Ode an die Welt der Spieler und Venture-Capitalists zu verfassen – eine Welt, die er mit dem Begriff "River" beschreibt.
Diese "Riverians", wie er sie nennt, sind vermeintlich die Gewinner in einem Spiel um Risiko und Wetteinsätze. Doch während Silver die Vorzüge dieser Mentalität lobt, ignoriert er die ernsten Probleme, die mit dem ungebremsten Wachstum der Glücksspielindustrie einhergehen. Die Glücksspielwirtschaft in den USA ist überwältigend. Im Jahr 2022 verloren Amerikaner schätzungsweise 130 Milliarden Dollar in Casinos, Lotterien und anderen Glücksspielangeboten. Die Wetteinsätze waren sogar zehnmal höher, was auf ein schier unerschöpfliches Verlangen nach Glücksspiel hinweist.
Aber diese Zahlen sind nicht nur beeindruckend; sie sind auch besorgniserregend. Silver präsentiert diese Industrie als reich und florierend, während er die Schattenseiten, wie die Zunahme von Spielsucht, weitgehend außer Acht lässt. Der erste Teil von "On the Edge" zielt darauf ab, die Glücksspielindustrie zu glorifizieren. Kapitel über Casinos und die Strategien, die verwendet werden, um Spieler in Versuchung zu führen, zeigen eine unkritische Haltung gegenüber dieser Branche. Silver skizziert die cleveren Strategien der Casinos, um Spieler an sich zu binden, inklusive Belohnungsprogrammen und manipulativen Glücksspielautomaten.
Anstatt die moralischen und sozialen Implikationen dieser Praktiken zu hinterfragen, präsentiert er sie als intelligente Geschäftsstrategien. Ein kritischer Punkt ist, dass Silver einen Mangel an Reflexion über die negativen externen Effekte des Glücksspiels zeigt. Er vergleicht die Glücksspielindustrie nicht selten mit der Pharmaindustrie und lobt ihre Fähigkeit zur Produktinnovation, ohne dabei zu begreifen, dass Glücksspiel süchtig machen kann und verheerende Auswirkungen auf das Leben der Menschen hat. Diese Verkürzung von komplexen sozialen Problemen auf einfache wirtschaftliche Analysen ist beunruhigend. Ein weiteres auffälliges Merkmal des Buches ist die Unstrukturiertheit.
In zwei Teilen versucht Silver, disparate Themen zu verbinden, wobei der mittlere Abschnitt wie ein Selbsthilfebuch über die "dreizehn Gewohnheiten erfolgreicher Risikoträger" wirkt. Die Kluft zwischen den verschiedenen Themen und Argumentationssträngen hinterlässt den Leser verwirrt, anstatt inspiriert. Silver selbst gibt zu, dass er von künstlicher Intelligenz unterstützt wurde. In den Danksagungen erwähnt er ChatGPT als seine "kreative Muse". Während dies für einige als innovativ angesehen werden könnte, wirft es Fragen zur Authentizität und zur Tiefe seines Denkens auf.
Der Eindruck, dass die Technologie ihm mehr geschadet als genützt hat, wird in der Darstellung seines eigenen Entscheidungsprozesses überdeutlich. Besonders bedenklich ist Silvers Ansatz zur systemischen Risikoanalyse. Er beschreibt das Wachstum des Glücksspiels als Ergebnis eines veränderten Nutzerverhaltens. In Wirklichkeit wurde dieser Anstieg jedoch vor allem durch politische Entscheidungen, wie die Legalisierung von Sportwetten durch den Supreme Court im Jahr 2018, begünstigt. Das Umdenken der Gesellschaft über Glücksspiele ist daher nicht nur eine Reaktion auf das Verhalten der Spieler, sondern auch ein Ergebnis des politischen und gesellschaftlichen Wandels.
Gesellschaftliche Probleme wie Spielsucht sollten ernst genommen werden und verdienen eine differenzierte Analyse. Stattdessen legt Silver den Fokus auf die individuellen Gewohnheiten von Risikoträgern, ohne die größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge zu berücksichtigen. Sein Mangel an kritischer Reflexion über die betrügerischen Aspekte des Glücksspiels und die Systematik, die es umgibt, zeugt von einer gefährlichen Naivität gegenüber den Folgen dieses "River"-Lifestyles. Karpf hebt hervor, dass Silver zwar in der Welt der Glücksspieler und Investoren profitabel sein mag, jedoch die breitere Gesellschaft ignoriert, die unter den Konsequenzen leidet. Besonders besorgniserregend ist die Zunahme von Spielsucht, die als direktes Ergebnis der unkontrollierten Werbung und des Zugangs zu Glücksspielangeboten in den letzten Jahren betrachtet werden kann.
Ein "Riverian"-Ansatz könnte leicht als Bekenntnis zu einer Welt interpretiert werden, in der die Schwächsten gleichzeitig die größten Verlierer sind. In den letzten Kapiteln des Buches thematisiert Silver die $43 Milliarden-Verluste, die durch den Fall von Sam Bankman-Fried entstanden sind. Diese und andere Beispiele zeigen, dass die Las Vegas-Ästhetik nicht nur auf den Glücksspielsektor beschränkt bleibt, sondern auch auf Schattenwirtschaften und riskante Investitionen übergreift. Bei all den gewagten Behauptungen und persönlichen Geschichten bleibt die Frage unbeantwortet: Welchen gesellschaftlichen Nutzen zieht man aus all diesen Wettsystemen, besonders in einer Welt, die unter massiven Ungleichheiten leidet? Silver zieht bis zum Schluss keine klaren Lehren aus seinen Überlegungen. Während er die große Rolle des Risikomanagements und der Kosten-Nutzen-Analyse für Risikoträger lobt, wird der Eindruck erweckt, dass er sich um die realen Gefahren und Verluste, die damit einhergehen, keinen Kopf macht.