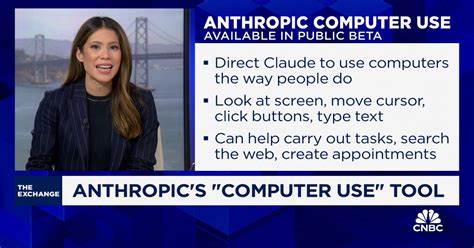Der kürzlich vom US Copyright Office veröffentlichte Vorabbericht zur Bewertung von Fair Use im Bereich des Trainings von Künstlicher Intelligenz sorgt für erhebliche Diskussionen und Zweifel hinsichtlich seiner institutionellen Legitimität und der inhaltlichen Konsistenz. Insbesondere die Kombination aus ungewöhnlichen Verfahren und einer widersprüchlichen Analyse ruft Kritik von Fachkreisen und Akteuren aus der Rechtswelt hervor. Die Relevanz dieses Berichts ergibt sich aus der wachsenden Bedeutung von KI-Technologien, welche sich zunehmend auf urheberrechtlich geschützte Werke stützen. Das US Copyright Office, als beratendes Organ für den Kongress, hat vor diesem Hintergrund eine zentrale Stellung im rechtlichen Diskurs, doch der vorliegende Bericht wirft Fragen auf, ob diese Rolle angemessen wahrgenommen wurde. Zunächst verdient die Frage Beachtung, welche institutionelle Funktion das Copyright Office im Kontext von Urheberrechtsfragen einnimmt.
Gemäß Section 701 des Copyright Act obliegt dem Register of Copyrights die Aufgabe, Studien durchzuführen und den Kongress in nationalen und internationalen Angelegenheiten zu beraten. Diese Rolle ist beratend und analytisch, mit dem Ziel, Entscheidungsgrundlagen für Gesetzgeber zu liefern. Der nun publizierte Bericht überschreitet jedoch diesen Rahmen und nimmt in mehreren Punkten faktische Stellung zu juristischen Streitfragen, die lediglich im Gerichtsverfahren zu klären sind. Das Vorgehen, Partei für bestimmte Rechtsauffassungen zu ergreifen, ist so nicht vorgesehen und steht im Spannungsverhältnis zur bewährten Trennung der Zuständigkeiten zwischen Verwaltung und Rechtsprechung. Ein besonders umstrittener Aspekt des Berichts ist die Einführung und Befürwortung eines neuartigen Konzepts der sogenannten „Marktverdünnung“ im Rahmen der vierten Fair-Use-Faktorbewertung.
Hierbei vertritt das Copyright Office die These, dass ein Urheberrecht auch dazu dienen müsse, den Markt in seiner Gesamtheit gegen Konkurrenz zu schützen, selbst wenn diese Konkurrenz nicht notwendigerweise eine direkte Urheberrechtsverletzung darstellt. Dies würde potentiell bedeuten, dass generative KI-Modelle, die etwa neue Werke in einem Genre wie Liebesromane oder Musik schaffen, eingeschränkt werden könnten, obwohl die erzeugten Werke rechtlich nicht als Verletzung gelten. Der Gedanke, dass der Schutz eines bestehenden Werkes vor einem grundsätzlichen Wettbewerb ausgedehnt wird, widerspricht jedoch dem in der Verfassung verankerten Prinzip, dass der Urheberrechtsschutz nur Mittel zum Zweck des Fortschritts sein darf, nicht aber ein Instrument zur Behinderung legitimen Wettbewerbs. Die methodische Herangehensweise des Berichts ist zudem bemerkenswert einseitig. Während Argumentationen zugunsten von Unternehmen, die KI-Technologie einsetzen, häufig strikt an bestehende, etablierte Fair-Use-Grenzen gebunden werden, öffnet die Analyse bei Themen, die Urheberrechtsinhabern genehm sind, den Raum für rechtliche Neuerungen ohne gesicherte Präzedenzfälle.
Damit entsteht ein zweierlei Maß, das nicht nur die Qualität der Beratung des Kongresses beeinträchtigen kann, sondern auch das grundlegende Prinzip rechtsstaatlicher Gleichbehandlung untergräbt. Darüber hinaus wirft die Veröffentlichung des Berichts untersetzt von politischen Turbulenzen und der kurzfristigen Ablösung der Registerin Shira Perlmutter, die den Bericht verantwortet hat, einen Schatten auf seine Verbindlichkeit und seinen künftigen Stellenwert. Die Ablehnung oder Überarbeitung durch nachfolgende Amtsinhaber oder die Administration bleibt eine realistische Möglichkeit, was die Rechtsunsicherheit in diesem sensiblen Bereich verstärkt. Die zentrale Debatte, die sich um Fair Use und das Training von KI dreht, ist von fundamentaler Bedeutung für Innovation, Wissenschaft und Kultur. Auf der einen Seite steht das berechtigte Interesse der Urheber, eine angemessene Vergütung und Anerkennung für ihre Werke zu erhalten.
Auf der anderen Seite steht das Erfordernis, dass neue Technologien und damit verbundene Geschäftsmodelle sich entfalten und gesellschaftliche Vorteile mit sich bringen können, ohne durch übermäßige Beschränkungen blockiert zu werden. Der „unchartered territory“-Zugang, den der Bericht an manchen Stellen einnimmt, provoziert deshalb Kontroversen. Er zeigt eine kreative, aber umstrittene Auslegung der Gesetzeslage, die nicht nur den Status quo herausfordert, sondern auch regulatorische Unsicherheiten erzeugt. Neben der inhaltlichen Kritik hat der Bericht auch auf der prozeduralen Ebene Defizite offenbar gemacht. Das Verfahrensdesign sieht eine umfassende und ausgewogene Anhörung aller relevanten Stakeholder vor, verbunden mit einem transparenten Prozess, der Interessenkonflikte minimiert.
Das Einbeziehen von Kommentaren aus noch anhängigen Gerichtsverfahren, bei denen die betroffenen Parteien direkt involviert sind, ohne einen fairen und gleichberechtigten Dialog sicherzustellen, könnte als unausgewogene Einflussnahme gewertet werden. Zudem bleibt die Frage offen, ob der Bericht in seinem Umfang und seiner Detailtiefe die Anforderungen an eine objektive und unparteiische Beratung erfüllt. Dieser Fall beleuchtet nicht zuletzt die Herausforderungen, die mit der Regulierung von Technologien einhergehen, die sehr schnell neue und bisher unklare Rechtsfragen aufwerfen. Das Spannungsfeld zwischen innovativen Entwicklungsmöglichkeiten und bewährtem Rechtsschutz verlangt flexible und zugleich verlässliche Antworten. Die Rolle von Institutionen wie dem US Copyright Office ist dabei zentral, da sie als Brücke zwischen Gesetzgebung, Praxis und technologischem Fortschritt fungieren.
Ein ausgewogenes, konsistentes und legitimiertes Verfahren ist dabei unerlässlich, um sowohl die Interessen der Urheber als auch der Entwickler und Nutzer zu schützen. Insgesamt zeigt die Debatte um den Vorabbericht des US Copyright Office exemplarisch, wie schwierig die Findung eines gemeinsamen Konsenses in diesem komplexen Feld ist. Die Kritik an methodischer Einseitigkeit und der Überschreitung institutioneller Kompetenzen dient als Warnsignal für die nächsten Schritte in der fair-use-Diskussion rund um KI. Ein transparenter und ausgewogener Dialog, der alle beteiligten Akteure fair berücksichtigt und klare Grenzen zwischen Beratung, Verwaltung und Gerichtsverfahren wahrt, ist unabdingbar für eine tragfähige und zukunftsorientierte Regulierung. Die Bedeutung dieser Thematik wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken, nicht zuletzt weil KI und maschinelles Lernen integrale Bestandteile zahlreicher wirtschaftlicher und kultureller Prozesse werden.
Ob und in welchem Umfang der Bericht des Copyright Office eine Rolle in der Rechtsprechung und Legislativplanung spielen wird, ist derzeit noch offen. Klar ist aber, dass der Umgang mit Fair Use im Zeitalter der KI eine der wichtigsten Fragen im Urheberrecht darstellt – und dass jede Analyse und Empfehlung mit höchster Sorgfalt, Sachlichkeit und institutioneller Zurückhaltung erfolgen sollte.
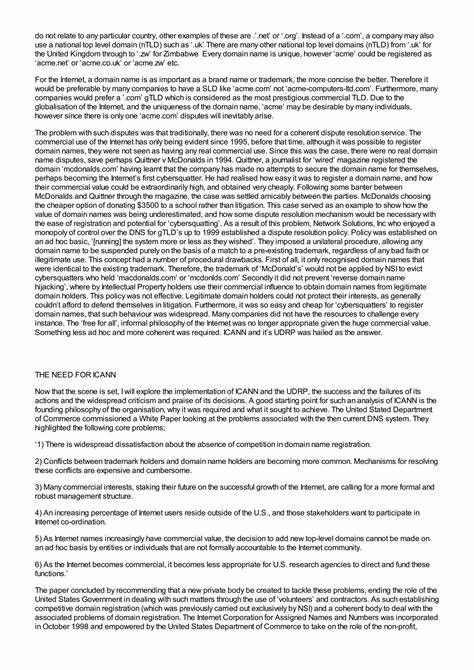


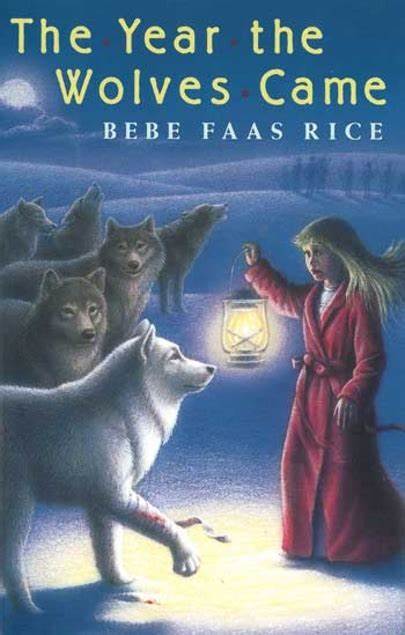

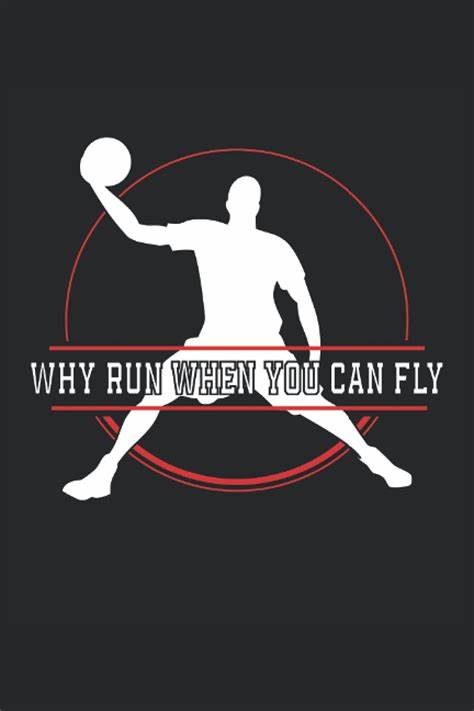
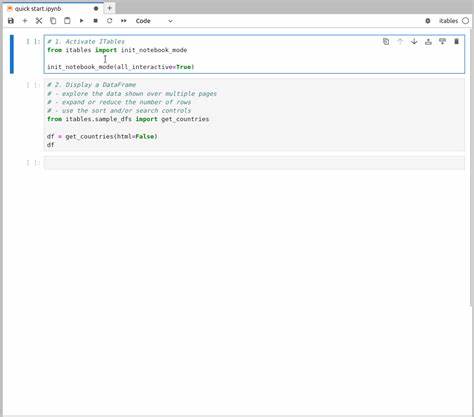
![The New Amazon Robot That Can Feel What It Touches [video]](/images/D55C4AE5-9BB3-4CE0-B82D-03E06176881D)