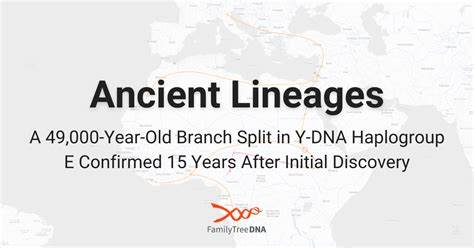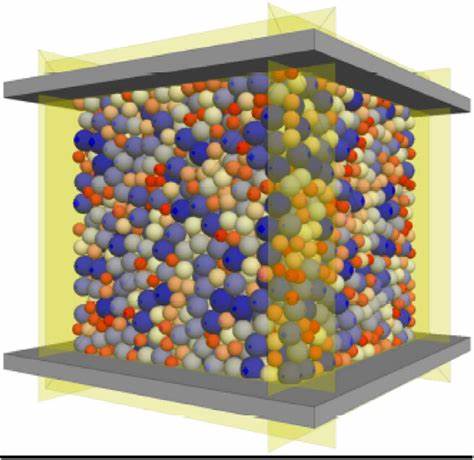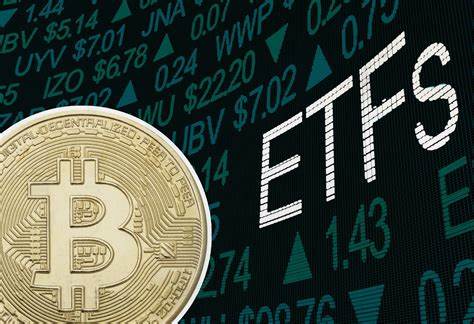Die Sahara ist heute vor allem als riesige, trockene Wüstenlandschaft bekannt, die eine der lebensfeindlichsten Regionen unseres Planeten darstellt. Doch die Geschichte dieses Gebiets erzählt ein ganz anderes Bild: Zwischen etwa 14.500 und 5.000 Jahren vor heute war die Sahara grün und fruchtbar. Dieser Zeitraum, bekannt als die Afrikanische Feuchteperiode, brachte malerische Savannenlandschaften, ausgedehnte Seen und Flusssysteme mit sich.
Diese landschaftlichen Veränderungen boten ideale Voraussetzungen für menschliche Besiedlung, Jagd und letztlich für die Entwicklung der Viehzucht – eine der bedeutendsten kulturellen Transformationen der Menschheitsgeschichte. Wissenschaftler haben sich lange gefragt, wie sich die frühe Bevölkerungsentwicklung und die Verbreitung der Viehzucht in dieser Region abspielten, insbesondere angesichts der schwierigen Bedingungen für die DNA-Erhaltung in heißen, trockenen Umgebungen. Neue Forschungen, die auf der Analyse von antiker DNA basieren, ermöglichen nun einen noch nie dagewesenen Einblick in die genetische Geschichte der grünen Sahara und offenbaren dabei eine bislang unbekannte nordafrikanische Abstammungslinie. Die bahnbrechende Studie analysierte das Genom zweier weiblicher Individuen, die vor etwa 7.000 Jahren im Takarkori-Felsenschutz in der Zentral-Sahara, im heutigen Südwest-Libyen, bestattet wurden.
Dieses Fundgebiet zählt zu den wichtigsten archäologischen Stätten für die Erforschung der saharischen Bevölkerungs- und Umweltgeschichte. Die Neolithiker, die in Takarkori lebten, waren Teil einer frühen Hirtenkultur, die wahrscheinlich domestiziertes Vieh hielt und eine ausgeprägte pastoralistische Lebensweise pflegte. Die genetische Datenauswertung zeigt, dass diese Individuen eine markante Abstammung von einer bisher unentdeckten nordafrikanischen genetischen Linie besitzen. Diese Linie spaltete sich evolutionär etwa zur gleichen Zeit von den sub-saharischen Abstammungslinien ab, als die heutigen nicht-afrikanischen Menschen Afrika verließen. Bemerkenswerterweise bleibt diese Linie über lange Zeiträume, vom späten Pleistozän bis in die mittlere Holozän-Zeit, genetisch isoliert.
Ein weiterer wichtiger Bezugspunkt für diese genetische Abstammungslinie sind die 15.000 Jahre alten Jäger und Sammler vom Taforalt-Höhlenkomplex in Marokko, deren genetisches Profil ähnlich ist. Die Taforalt-Funde sind mit der sogenannten Iberomaurusischen Steinzeitindustrie verknüpft und liegen somit vor der Afrikanischen Feuchteperiode. Die Analyse zeigt, dass sowohl die Takarkori- als auch die Taforalt-Populationen gleichermaßen distanziert sind von den sub-saharischen Genlinien. Diese Erkenntnis legt nahe, dass während der Afrikanischen Feuchteperiode entgegen früherer Annahmen nur sehr geringe genetische Durchmischungen zwischen Nord- und Sub-Sahara-Afrika stattfanden.
Die Sahara fungierte trotz ihrer damaligen grünen Phasen weiterhin als bedeutende Barriere für den genetischen Austausch. Interessant ist auch der Umstand, dass die Takarkori-Individuen weniger Neandertaler-DNA aufweisen als ihre Zeitgenossen aus dem Nahen Osten, aber dennoch mehr als heutige Sub-Sahara-Afrikaner. Das bedeutet, dass ein geringfügiger aber bedeutsamer Einkehr von Genmaterial von außerhalb Afrikas stattfand, jedoch in einem Ausmaß, das eine lange Isolation der Population belegt. Dies lässt den Schluss zu, dass die Verbreitung von Viehzucht und pastoralistischen Praktiken in der grünen Sahara vor allem durch kulturelle Diffusion ermöglich wurde. Das heißt, Wissen und Techniken wurden weitergegeben, ohne dass größere Populationen von außerhalb einwanderten und die lokalen genetischen Strukturen grundlegend veränderten.
Archäologische Funde am Takarkori-Felsenschutz stützen diese genetischen Befunde zusätzlich: Zeugnisse von materieller Kultur wie Keramik, Körbe, Werkzeuge aus Knochen und Holz, sowie die Anzeichen zunehmender Sesshaftigkeit deuten auf eine komplexe Gesellschaft hin, die sich über Generationen entwickelte, vermutlich mit kontinuierlicher kultureller Innovation und sozialen Wandel. Dabei entsteht ein Bild von Bevölkerungsgruppen, die in der Sahara angesiedelt waren und relativ autonom ihre Lebensweise entwickelten, trotz ihrer Einbettung in ein weiter reichendes Netzwerk prähistorischer Kulturen und Handelsbeziehungen. Zudem stellt die genetische Analyse der mitochondrialen DNA der Takarkori-Individuen eine der tiefsten noch bekannten Linien außerhalb Subsahara-Afrikas dar. Die Haplogruppe N, der sie zugehören, ist eine der ältesten mitochondrialen Linien, die außerhalb Afrikas nachgewiesen wurden, und stellt die Basis vieler heutiger Eurasischer Abstammungslinien dar. Dies wirft ein Licht auf den Ursprung und die Verbreitung von Menschen nach dem sogenannten Auszug aus Afrika, zeigt aber auch, dass einige Populationen lange in Nordafrika verblieben und genetisch einzigartig blieben.
Die Kombination aus genetischen Erkenntnissen und archäologischen Befunden trägt wesentlich dazu bei, die komplexen Dynamiken während der Afrikanischen Feuchteperiode und der darauffolgenden allmählichen Wiederverödung der Sahara besser zu verstehen. Während die Grüne Sahara lebendige Ökosysteme und attraktive Lebensräume beherbergte, führte die zunehmende Austrocknung vor etwa 5.000 Jahren zu einer massiven Verschiebung der Bevölkerungsstruktur. Vielerorts mussten die Menschen in marginalere Regionen ausweichen oder neue Formen der Subsistenz und sozialen Organisation entwickeln. Besonders spannend sind zudem die Verbindungen, die sich genetisch zwischen den Menschen der Zentral-Sahara und heutigen Bevölkerungsgruppen in der Sahelzone und Westafrika erkennen lassen.
So zeigen genetische Ähnlichkeiten zwischen den Takarkori-Pastoralisten und modernen Fulani, einer nomadischen Hirtenbevölkerung, dass späte Wanderungsbewegungen aus der grünen Sahara hinaus stattfanden. Die Fulani gelten als eine der heute bekanntesten Völkergruppen mit Teilhabe am Erbe der Saharapastoralisten. Die Forschung unterstreicht auch, wie schwierig es ist, die genetische Geschichte Nordafrikas durch den Mangel an gut erhaltenen DNA-Proben zu rekonstruieren. Besonders in heißen Wüstenregionen werden DNA-Fragmente schnell abgebaut, was die Gewinnung hochqualitativer Genomdaten in der Region erschwert. Daher sind die Erfolge bei der Gewinnung von 7.
000 Jahre alten Genomen aus Takarkori ein Meilenstein für die Paläogenetik Afrikas. Die gewonnenen Daten verändern zudem die bis dato gültigen Modelle über die Bevölkerungsbewegungen in Nordafrika. Frühere Modelle nahmen eine bedeutende genetische Vermischung zwischen Sub-Sahara und Nordafrika während der grünen Sahara an. Die neuen Ergebnisse zeigen jedoch, dass die genetischen Linien Nordafrikas größtenteils unabhängig von jener im südlichen Afrika blieben, was bedeutet, dass ökologische, kulturelle und vielleicht soziale Barrieren zur genetischen Isolation führten – trotz scheinbar günstiger Umweltbedingungen für Migrationen. Zusammenfassend zeigt die Studie, dass die Bevölkerung der Grünen Sahara in der mittleren Holozän-Zeit von einer tief divergenten, eigenständigen nordafrikanischen Linie abstammte, die in Teilen bis in das späte Pleistozän zurückreicht.
Die Verbreitung von pastoralistischen Praktiken im Zentral-Sahara-Gebiet verlief überwiegend durch den Austausch von Kultur und Wissen, nicht durch großflächige Migrationen. Der genetische Einfluss von Gruppen aus dem Nahen Osten oder Sub-Sahara-Afrika war begrenzt, was eine lokal adaptierte Entwicklung begünstigte. Diese Erkenntnisse bieten neue Perspektiven auf die Geschichte der menschlichen Besiedlung Nordafrikas und dessen Rolle in der globalen Entwicklung prähistorischer Kulturen. Sie helfen besser zu verstehen, wie Menschen sich an extreme Umweltanforderungen anpassen, kulturelle Innovationen austauschen und dennoch genetisch isoliert bleiben können. Außerdem unterstützen sie die Idee, dass Nordafrika, auch in Zeiten günstiger klimatischer Bedingungen, eine einzigartige genetische Region darstellte, die maßgeblich zur Diversität des modernen Menschen beitrug.
Blick in die Zukunft eröffnet die Studie die Möglichkeit, weitere alte DNA-Proben aus der Sahara und angrenzenden Gebieten zu untersuchen. Mit der technischen Weiterentwicklung in der DNA-Sequenzierung könnten zukünftige Analysen noch tieferliegende Details zu Bevölkerungsbewegungen, zu kulturellem Wandel und zu Umweltveränderungen in dieser Schlüsselregion liefern. Dies wird nicht nur der Anthropologie und Archäologie zugutekommen, sondern auch ein besseres Verständnis der frühesten Kapitel unserer globalen menschlichen Geschichte ermöglichen.