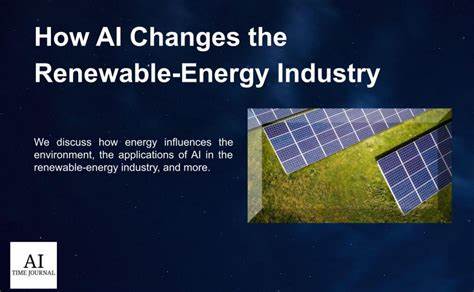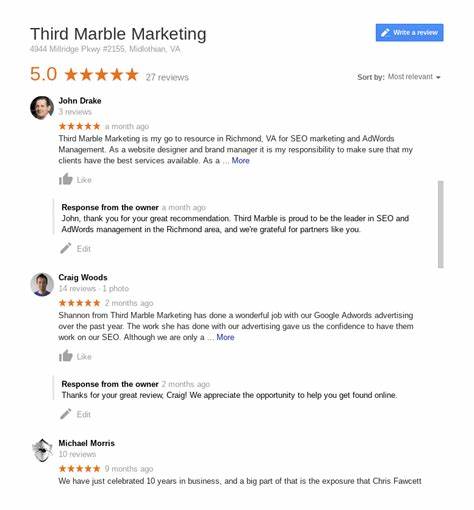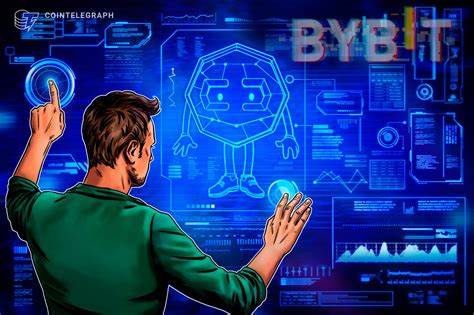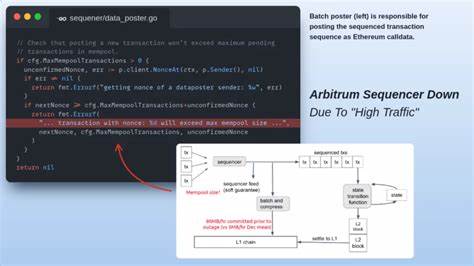Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren nicht nur technologische Innovationen vorangetrieben, sondern auch die Anforderungen an Energieinfrastruktur und Ressourcennutzung maßgeblich verändert. Trotz der oft geäußerten Befürchtungen über den steigenden Energiebedarf von KI-Systemen ist der relative Energieverbrauch bisher noch vergleichsweise gering. Doch gerade wegen des erwarteten zukünftigen Wachstums sowie der regionalen Konzentration von Rechenzentren ist der Umgang mit dem Energiebedarf von KI heute von zentraler Bedeutung, wenn wir die Herausforderungen der umfassenden Elektrifizierung unserer Wirtschaft und die Ziele des Klimaschutzes erreichen wollen. Die steigende Nachfrage nach Rechenleistung, insbesondere getrieben durch aufwendige KI-Modelle und Deep-Learning-Verfahren, führt zu einer erhöhten Belastung der Datenzentren – den Herzstücken der digitalen Infrastruktur. Insbesondere Grafikprozessoren (GPUs), die in KI-Berechnungen eine zentrale Rolle spielen, wurden in den letzten Jahren deutlich günstiger und leistungsfähiger.
Seit 2006 fiel der Preis dieser Technologien um etwa 99 Prozent, was eine explosionsartige Verbreitung und Nutzung von KI-Lösungen möglich machte. Früher wurde bereits in den 2010er Jahren eine rapide Zunahme des Energiebedarfs von Datenzentren prognostiziert. Diese Vorhersagen erwiesen sich allerdings zunächst als zu pessimistisch, da technologische Fortschritte bei der Energieeffizienz zu einem enormen Leistungszuwachs bei nur minimalem Mehrverbrauch führten. Zwischen 2010 und 2018 stieg die globale Rechenkapazität sogar um mehr als 550 Prozent, ohne dass sich der Energieverbrauch parallel dazu stark erhöhte. Diese Entwicklung verlieh der Branche und den Klimaforschern zunächst Hoffnung, dass technologischer Fortschritt die ökologischen Folgen beherrschbar machen könnte.
Doch seit Ende der 2010er Jahre zeichnen sich neue Trends ab. Die steigende Genauigkeit und Komplexität moderner KI-Anwendungen führt zu einem wieder anziehenden Wachstum des Stromverbrauchs in Rechenzentren. Aktuell verbrauchen diese Zentren etwa 4,4 Prozent des gesamten Strombedarfs in den USA – eine Steigerung gegenüber 1,9 Prozent im Jahr 2018. Besonders in einigen Bundesstaaten hat der Energiebedarf dieser Einrichtungen schon erhebliche Ausmaße angenommen. In Virginia, einem bedeutenden Zentrum für Datenzentren, sind es mittlerweile sogar 25 Prozent des Stromverbrauchs, die auf diese Branche entfallen.
Die Prognosen über die zukünftige Entwicklung sind unterschiedlich und von vielen Variablen abhängig. Studien wie jene des Lawrence Berkeley National Laboratory gehen davon aus, dass der Anteil von Datenzentren am US-Stromverbrauch bis 2028 zwischen sechs und zwölf Prozent liegen könnte. Diese mögliche Steigerung hat weitreichende Konsequenzen für die öffentliche Infrastruktur, Energiekosten und Umweltbelastungen. Besonders problematisch ist die Tatsache, dass der bisher eingesetzte Strom zum Großteil noch aus fossilen Quellen stammt oder durch den Neubau gasbetriebener Kraftwerke gedeckt werden soll. Eine solche Entwicklung könnte die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sogar verstärken und den Klimaschutz konterkarieren.
Dabei ist es wichtig zu betonen, dass das Gesamtwachstum des Stromverbrauchs in den nächsten Jahren nicht nur von KI und Datenzentren geprägt wird. Die Elektrifizierung von Fahrzeugen, Gebäuden und der Industrie wird zusammengenommen vermutlich den größeren Anteil am Mehrverbrauch ausmachen. Studien erwarten, dass die gesamte Stromerzeugung in den USA in etwa um 24 bis 29 Prozent steigen wird, wovon knapp ein Viertel dem Bereich der Künstlichen Intelligenz und Datenzentren zuzurechnen ist. Obwohl dies im Gesamtbild noch eine vergleichsweise kleine Größenordnung darstellt, ist die Dringlichkeit, nachhaltige Lösungen für die Energieversorgung von Datenzentren zu finden, besonders hoch. Der Grund liegt neben dem jüngsten starken Wachstum vor allem in der starken regionalen Konzentration von Datenzentren, die lokal sehr hohe Belastungen für das Stromnetz bedeuten können und somit neue Herausforderungen für die Netzstabilität und die Versorgungssicherheit darstellen.
Gleichzeitig ist es wichtig, die Kosten und Emissionen, die durch den Betrieb und die Herstellung von KI-Technologien entstehen, auch im Verhältnis zu den potenziellen positiven Auswirkungen von KI zu betrachten. Künstliche Intelligenz kann beispielsweise dazu beitragen, den Energieverbrauch anderer Sektoren signifikant zu senken, etwa durch Optimierungen im Stromnetz, in der Verkehrsplanung, in der Gebäudetechnik oder bei industriellen Prozessen. Insbesondere die Entwicklung neuer Materialien oder Energiespeicher von KI-getriebenen Forschungsprojekten könnte langfristig sogar zur besseren Integration erneuerbarer Energien beitragen und damit einen direkten positiven Einfluss auf die Klimabilanz haben. Dennoch besteht auch die Gefahr, dass KI-Anwendungen diesen Fortschritt teilweise aushebeln, indem sie etwa die Erkundung und Förderung fossiler Energieträger effizienter machen. Deshalb ist eine kontinuierliche und kritische Bewertung der ökologischen Effekte von KI essenziell, damit die Versprechungen nachhaltiger Vorteile keine reinen Lippenbekenntnisse bleiben.
Die aktuelle Situation erinnert daran, dass exponentielles Wachstum des Energiebedarfs früher schon ähnliche Herausforderungen mit sich brachte. In den 1960er bis 1990er Jahren gab es kontinuierlich hohe Wachstumsraten im Stromverbrauch, die dann ab etwa 2005 eine längere Phase der Stagnation erlebten. Für die Zukunft kehren viele Prognosen wieder auf ein moderates Wachstum von rund zwei Prozent pro Jahr zurück, allerdings vor dem Hintergrund völlig neuer Anforderungen und technologischer Verschiebungen. Um den Energiebedarf von KI und Datenzentren in eine klimafreundliche Richtung zu lenken, bedarf es eines umfassenden „Grid New Deal“ – also eines groß angelegten Projekts zur Modernisierung und Digitalisierung der Stromnetze. Dies umfasst Investitionen in neue und saubere Energiequellen wie Wind, Solar und gegebenenfalls nachhaltige Kernenergie, ebenso wie den Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze.
Effiziente Steuerungssysteme, die sogenannte virtuelle Lastverschiebung ermöglichen, können dazu beitragen, Stromverbrauch und Erzeugung besser zu synchronisieren und Lastspitzen abzufedern. Dabei sollte der Anschluss von neuen Datenzentren an das Stromnetz bevorzugt mit Ökostrom erfolgen, begleitet von Investitionen in die notwendige Infrastruktur. Finanzielle Förderungen und steuerliche Anreize könnten hier die Akzeptanz und Umsetzung beschleunigen. Transparenz bei der Veröffentlichung von Energieverbrauchsdaten durch Betreiber von Rechenzentren spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um eine fundierte Bewertung der environmental und sozialen Auswirkungen zu gewährleisten und lokale Gemeinschaften einzubeziehen. Die politische Ebene hat erste Schritte unternommen, etwa durch die Veröffentlichung von Grundsätzen für den Schutz der Rechte und Chancen der Bevölkerung im Umgang mit KI („AI Bill of Rights“).
Eine Klimakomponente, die explizit nachhaltige und energiesparende Aspekte von KI in den Vordergrund stellt, wäre ein richtiger und notwendiger nächster Schritt, um ethische Fragestellungen mit Umweltbewusstsein zu verbinden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die digitale Revolution nicht zu Lasten der Umwelt und der gesellschaftlichen Resilienz geht. Insgesamt sollte die Diskussion über den Energieverbrauch von KI und Datenzentren eingebettet sein in den größeren Kontext der globalen Energie- und Klimawende. Die Herausforderung, den wachsenden Strombedarf zu bewältigen, ist eine Wegmarke dafür, wie Gesellschaft, Wirtschaft und Politik den Prozess umfassender Elektrifizierung und Dekarbonisierung meistern. Derzeit ist der Energieverbrauch von KI zwar noch relativ klein, doch die Art und Weise, wie wir diese Herausforderung angehen, ist entscheidend für die Chancen, unsere Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die Vorteile von KI-Technologien breit und gerecht nutzbar zu machen.
Die Zukunft der KI wird nicht nur von technischen Innovationen geprägt sein, sondern auch davon, wie nachhaltig und verantwortungsvoll wir mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten umgehen.