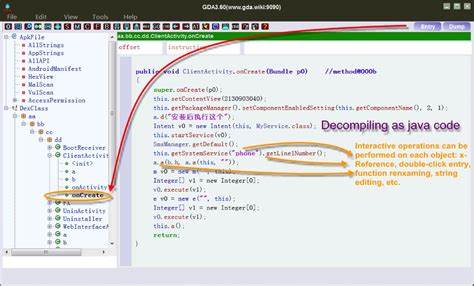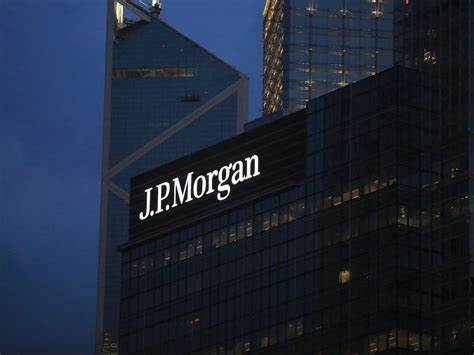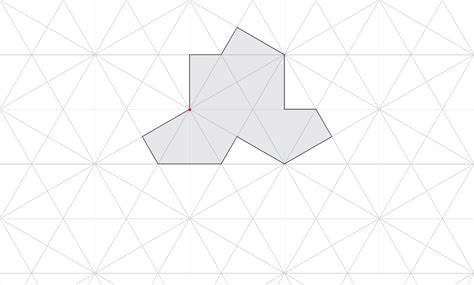In der heutigen globalisierten Welt ist die Zusammenarbeit zwischen Staaten in der Strafverfolgung von transnationalen kriminellen Organisationen von entscheidender Bedeutung. Doch diese Kooperation kann durch staatliche Akteure erheblich erschwert werden, wenn sie Ermittlungen verzögern, behindern oder unterwandern. Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür liefert die jüngste Untersuchung der US-amerikanischen Ermittlungen gegen die berüchtigte Gang MS-13 in El Salvador und die Rolle der dortigen Regierung unter Präsident Nayib Bukele. MS-13, kurz für Mara Salvatrucha, ist eine kriminelle Organisation, die sich in den 1980er Jahren in den USA unter salvadorianischen Migranten gründete und mit der Zeit eine global operierende Bande mit erheblichem Einfluss wurde. Die Gang zeichnet sich durch extreme Gewalt, komplexe Strukturen und enge Verknüpfungen zwischen den USA und Zentralamerika aus.
Aus diesem Grund haben amerikanische Behörden großes Interesse daran, die Führungspersönlichkeiten dieser Organisation zur Rechenschaft zu ziehen. Die US-Regierung reagierte auf diese Bedrohung mit der Schaffung der sogenannten Joint Task Force Vulcan, einem interdisziplinären, multiagenten Team, das darauf spezialisiert war, die Führungsebene von MS-13 sowohl in den USA als auch in Zentralamerika zu ermitteln und vor Gericht zu bringen. Vulcan wurde auf Anweisung von Präsident Donald Trump ins Leben gerufen und war mit Bundesbehörden wie dem FBI, dem Justizministerium und weiteren Strafverfolgungsbehörden besetzt. Während die Ankündigung des Kampfes gegen MS-13 Trump und Bukele zum Anlass nahm, eine politische Partnerschaft zu feiern, zeigte die Untersuchung von ProPublica jedoch, dass die Regierung von El Salvador unter Bukele selbst die Arbeit der Task Force systematisch behinderte. Obwohl Bukele international als harter Gegner der Gang gilt und sich mit rigorosen Maßnahmen zur Gefangennahme von tausenden mutmaßlichen Mitgliedern in Szene setzte, verhinderten seine engsten Mitarbeiter gleichzeitig die Auslieferung wichtiger Führungskräfte an die USA.
Diese Verhinderung erfolgte auf verschiedene Weise. Zum einen blockierten Schlüsselpersonen in Bukeles Umfeld die rechtlichen und institutionellen Verfahren im Zusammenhang mit den Auslieferungen. Nach der Absetzung des salvadorianischen Generalstaatsanwalts Raúl Melara und mehrerer Verfassungsrichter — eine Maßnahme, die international als Machtkonzentration kritisiert wurde — begannen neue Gerichte, Anfragen der USA auf Auslieferung bedeutender Gangmitglieder systematisch abzulehnen oder zu verzögern, oft mit fadenscheinigen juristischen Begründungen. Dabei scheint der eigentliche Grund die Angst gewesen zu sein, dass ausländische Gerichtsverfahren belastende Zeugenaussagen oder Beweise gegen Bukele und sein Inneres Umfeld zutage fördern könnten. Berichte legen nahe, dass Bukele mit MS-13 heimliche Vereinbarungen getroffen hatte, bei denen Gangführer die Anzahl der Morde senken sollten, um politische Stabilität und Wahlerfolge für Bukele und seine Partei Nuevas Ideas zu sichern.
Im Gegenzug soll die Gang finanzielle Vorteile, politische Unterstützung und Immunität vor Auslieferungen erhalten haben. Noch schwerwiegender ist die Behauptung, dass Mittel der US-Hilfsagentur USAID, die eigentlich für soziale Entwicklungsprogramme vorgesehen waren, teilweise in Richtung der Gang umgeleitet worden seien. Interne Ermittlungsdokumente belegen, dass die Vulcan Task Force Verdachtsmomente auf Geldwäsche und politische Finanzierung durch Gangmittel untersuchte. Eine Aufstellung führte Präsident Bukele, Mitglieder seines Stabs sowie weitere einflussreiche Persönlichkeiten El Salvadors als Verdächtige auf. Diese Vorwürfe wurden jedoch von der Regierung vehement bestritten.
Bukele bezeichnete die Deportation von MS-13-Mitgliedern durch die USA nach El Salvador als Willkommenszeichen für eine effektive Gangbekämpfung. Gleichzeitig zeigte sich die Regierung weniger kooperativ gegenüber Belastungszeugen oder den amerikanischen Ermittlern. Die Behinderung der Ermittlungen ging so weit, dass U.S. Behörden gezwungen waren, einigen salvadorianischen Ermittlern Schutz und eine Umsiedlung in die Vereinigten Staaten zu ermöglichen.
Diese Personen hatten die Task Force unterstützt und sahen sich in ihrer Heimat Repressalien, Überwachung und Bedrohungen ausgesetzt. Der zunehmende politische Druck und die gezielten Personaleingriffe durch Bukele förderten so die wachsende Distanz zwischen den Strafverfolgungsbehörden beider Länder. Neben juristischen Verzögerungen waren auch tatsächliche Fluchten und Freilassungen von mutmaßlichen MS-13-Führungspersonen dokumentiert, die die Arbeit von US-Ermittlern erheblich erschwerten. So wurde etwa die Ausbruchshilfe eines bekannten Gangführers mit direkten Verbindungen zu Regierungsmitgliedern in verschiedenen Berichten und Abhörprotokollen belegt. Die politische Dimension dieses Vorgehens wird durch die Unterstützung des Trump-Teams deutlich, das das Thema MS-13 als Teil einer Strategie gegen Migration und nationale Sicherheit instrumentalisierte.
Das Weißes Haus bekundete öffentlich seine Freundschaft zu Bukele und freute sich über dessen kompromisslose Gangbekämpfung – trotz der bekannten und von Unabhängigen belegten Behinderungen bei der Verfolgung der MS-13-Elite. Mit dem Regierungswechsel in den USA und dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden kam es zu einem Nachlassen der Prioritätensetzung für die Vulcan Task Force. Einige ehemalige Teammitglieder kritisierten, dass Ressourcen gekürzt und bürokratische Hürden erhöht worden seien, was sich ebenfalls in einer verlangsamten Ermittlungsarbeit widerspiegelte. Gleichzeitig behaften sich die Beziehungen zwischen Washington und San Salvador weiterhin mit Spannungen, die auf autoritäre Machtkonzentration und Einschränkungen der Rechtstaatlichkeit in El Salvador zurückzuführen sind. 2022 eskalierte die Ganggewalt in El Salvador deutlich, was Bukele wiederum zu rigorosen staatlichen Ausnahmemaßnahmen veranlasste, wie der Ausrufung eines „Ausnahmezustands“, der massive Verhaftungen und die Errichtung einer Hochsicherheitsgefängnisanlage mit Tausenden von Inhaftierten mit sich brachte.
Diese Politik genießt in der Bevölkerung breite Unterstützung, steht jedoch in der Kritik von Menschenrechtsorganisationen, die zivilgesellschaftliche und demokratische Standards sehen bedroht. Trotz der harten Gangbekämpfung gegen die Basismitglieder von MS-13 hält die salvadorianische Regierung weiterhin an einer ablehnenden Haltung gegenüber der Auslieferung von ranghohen Gangmitgliedern fest. Dies liegt mutmaßlich daran, dass diese Führungspersonen als Zeugen und Beweisträger potentieller Absprachen mit der Regierung gesehen werden und deshalb besondere politische Bedeutung haben. Auch diplomatisch wirkte sich diese Strategie aus: Die USA konnten zwar teilweise über mittlere und niedrige Führungsebene MS-13-Mitglieder festnehmen, die über Mexiko abgeschoben wurden, doch die Hauptziele der Ermittlungen, die höchsten Chargen in El Salvador, blieben praktisch geschützt. In einem bemerkenswerten Schritt wurden dennoch Ermittlungsverfahren gegen verschiedene hochrangige MS-13-Mitglieder in den USA fallengelassen, was eine Rückführung und Freilassung in El Salvador ermöglichte.
Diese Entscheidungen, die sich mit der politischen Vereinbarung zwischen den USA und Bukele überschnitten, werden von Experten als politisch motiviert gewertet und stehen im Widerspruch zu den ursprünglichen Zielen der Task Force. Die Rolle von Verzögerungen, Behinderung und Unterwanderung als Instrumente der Einflussnahme und Machterhalt lässt sich anhand des Falles El Salvador eindrücklich nachvollziehen. Die Verschiebung von Justizallianzen, die Manipulation von Gerichtsentscheidungen zugunsten krimineller Akteure sowie systematische Einschüchterung von Ermittlern stellen schwerwiegende Hindernisse erfolgreicher Strafverfolgung dar. Diese Dynamiken zeigen exemplarisch, wie fragile die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen transnationale organisierte Kriminalität ist, wenn politische Interessen und Korruption die Rechtsstaatlichkeit untergraben. Gleichzeitig illustriert der Fall die Grenzen der Einflussmöglichkeiten externer Ermittlungen, wenn nationale Regierungen eigene Geheimpakte mit kriminellen Gruppen eingehen.
Für die Zukunft bedeutet dies, dass sowohl internationale Organisationen als auch Strafverfolgungsbehörden verstärkt auf transparente Strukturen, Schutz für Whistleblower und nachhaltige Zusammenarbeit angewiesen sind, um solchen Behinderungen zu begegnen. Nur durch eine Kombination aus politischem Willen, Rechtsstaatlichkeit und grenzüberschreitender Koordination kann die Bedrohung durch Gangkriminalität wirksam eingedämmt werden. Der Fall Schärft zudem das Bewusstsein, dass Staaten, die offiziell als Partner im Kampf gegen das Verbrechen gelten, gleichzeitig ihre eigenen Interessen verfolgen und im Extremfall sogar illegale Allianzen mit kriminellen Organisationen eingehen können. Dieses Spannungsfeld stellt eine dauerhafte Herausforderung für die internationale Strafverfolgung dar und bedarf ständiger kritischer Beobachtung, umfangreicher Informationsarbeit und politischer Sensibilität. Letztlich zeigt sich, dass Verzögerung, Behinderung und Unterwanderung nicht nur taktische Mittel in juristischen Prozessen sind, sondern auch Zeichen tieferer struktureller Probleme in Politik und Rechtsstaatlichkeit.
Der Fall El Salvador und MS-13 ist ein Mahnmal dafür, wie dünn die Linie zwischen staatlicher Ordnung und krimineller Kooptation sein kann – und wie wichtig die Wachsamkeit von Ermittlern, Medien und der internationalen Gemeinschaft bleibt.