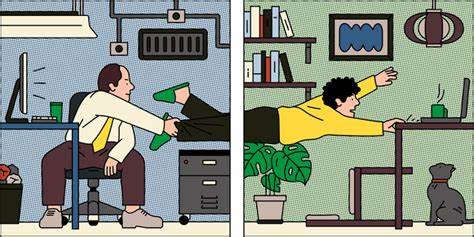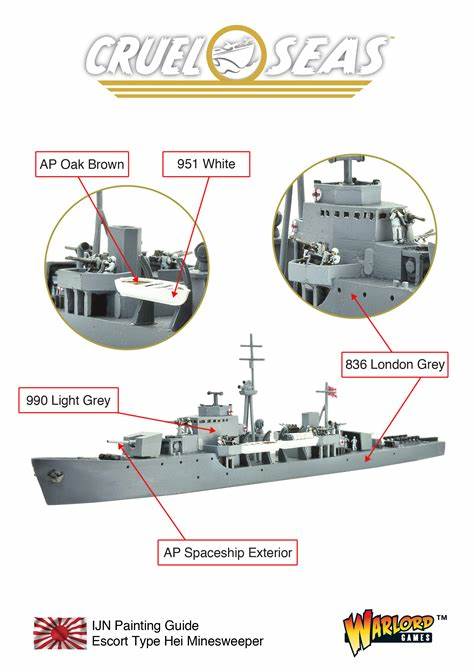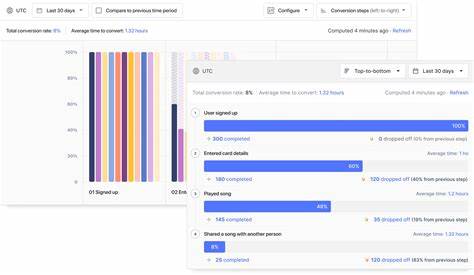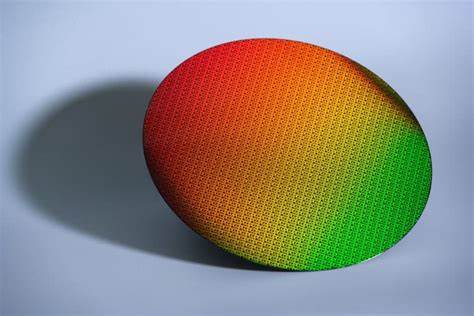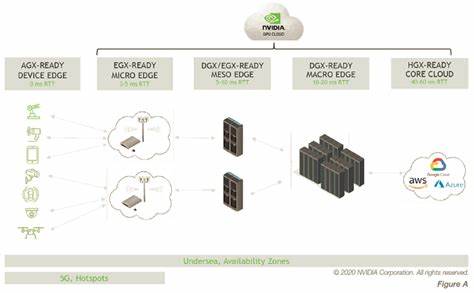Die Arbeitswelt befindet sich in einem stetigen Wandel, insbesondere seit dem Aufkommen neuer Technologien und der Covid-19-Pandemie. Während lange Zeit die Rückkehr ins Büro („Return To Office“) als wichtiger Schritt zur Wiederbelebung der Unternehmenskultur und zur Produktivitätssteigerung galt, zeichnet sich nun ein neuer Trend ab: „AI-first“. Dieser Trend, vorangetrieben von führenden CEOs und Tech-Unternehmen, fordert die konsequente Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in sämtliche Arbeitsprozesse. Die Einführung von „AI-first“ markiert dabei nicht nur einen technologischen Richtungswechsel, sondern verändert auch grundlegend die Unternehmenskultur sowie den Umgang von Führungskräften und Mitarbeitenden miteinander. Aber was steckt genau hinter diesem Begriff, warum ist er so stark in Mode gekommen, und welche Auswirkungen hat das auf Unternehmen und ihre Beschäftigten? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt es sich, die Hintergründe und die Bewegung hinter „AI-first“ kritisch zu beleuchten.
Die Bezeichnung „AI-first“ beschreibt eine Unternehmensstrategie, bei der der Einsatz von KI und insbesondere von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) zur selbstverständlichen Basis jeder Tätigkeit erklärt wird. Diese Strategie setzt voraus, dass Mitarbeitende diese Werkzeuge für ihre Arbeit nutzen – unabhängig davon, ob sie tatsächlich hilfreich oder nötig sind. Oftmals einher geht diese Haltung mit der Erwartung, dass die Nutzung von KI-Anwendungen in Leistungsbeurteilungen und Mitarbeitergesprächen berücksichtigt wird. Dahinter verbirgt sich eine interessante Dynamik: Statt den Mitarbeitenden zu vertrauen, selbst zu entscheiden, welche Werkzeuge sie nutzen möchten, wird ihnen die KI-Nutzung quasi von oben verordnet. Besonders bemerkenswert ist, dass viele dieser „AI-first“-Initiativen durch ähnlich formulierte Memos von Tech-CEOs bekannt wurden, die eine Art manifeste Kampagne für den KI-Einsatz führen.
Shopify-CEO Tobi Lütke gilt als einer der prominentesten Verfechter dieses Trends. Sein Aufruf, alle Mitarbeiter dazu zu bringen, KI-Alltagswerkzeuge zu integrieren und die Nutzung bei Leistungsbewertungen zu berücksichtigen, zeigt deutlich den Druck, der hier entsteht. Doch ist diese Vorgabe wirklich sinnvoll? Ist es klug, alle Mitarbeitenden dazu zu zwingen, KI-Werkzeuge intensiv zu nutzen? Hier zeigt sich eine mögliche Schwäche von „AI-first“. KI kann für helfende Unterstützung nützlich sein, vor allem für Personen, die bei bestimmten Aufgaben unterdurchschnittlich sind oder ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Ein versierter Entwickler, der sich etwa schon lange mit Frontend-Programmierung beschäftigt hat, wird KI-Tools anders nutzen oder vielleicht gar nicht benötigen als jemand, der selten programmiert.
Auch bei kreativem Arbeiten, etwa beim Schreiben oder komplexen Analysieren, ist der menschliche Faktor oft entscheidend. KI-Modelle können zwar Texte generieren und Informationen zusammenfassen, sie besitzen aber keine Kreativität oder ein eigenes Verständnis. Menschen können hingegen kontextsensibel denken, Humor erkennen oder originelle Einfälle haben. Ein Beispiel zeigt dies anschaulich: Anil Dash, Autor und Technologen, weist darauf hin, dass er dank seiner Kreativität und spezifischer Erfahrung Reaktionen mit seinem Text hervorrufen konnte, die KI-Modelle einfach nicht reproduzieren könnten. Diese Unterscheidung ist zentral, denn eine starre „AI-first“-Vorschrift kann implizieren, dass das Management Zweifel an der Kompetenz seiner Mitarbeiter hegt – warum sonst sollte es notwendig sein, die KI-Nutzung penibel vorzuschreiben und sogar zu bewerten? In vielen bisherigen Technologierevolutionen wie bei der Einführung von E-Mail, Tabellenkalkulationen oder Kollaborationstools mussten Unternehmen ihre Mitarbeitenden nicht zur Nutzung zwingen.
In der Regel wurde der Mehrwert der neuen Technologien von den Nutzern selbst erkannt und angenommen. Das Verhalten bei „AI-first“ steht also in einem gewissen Widerspruch zu dieser Erfahrung und lässt sich vielleicht besser durch Gruppendruck und den Wunsch, innerhalb der Branche „richtig“ zu handeln, erklären. Tech-CEOs tendieren dazu, Trends nachzueifern, die von ihren Kollegen oder Investoren erwartet werden. Der Drang, voranzugehen und modern zu erscheinen, erzeugt eine Art Gruppenzwang. Ähnlich wie die Rückkehr-ins-Büro-Bewegung der vergangenen Jahre, bei der Führungskräfte auf die vermeintliche Notwendigkeit beharrten, Mitarbeitende wieder physisch zu versammeln, dient „AI-first“ auch als Signal an die Ökosysteme von Investoren und anderen Führungspersönlichkeiten.
Tatsächlich wirkt „AI-first“ wie ein Modetrend in der Tech-Welt, eine Performance nach außen, die zeigen soll, dass ein Unternehmen im Zentrum der Innovation steht. Für die Mitarbeitenden bedeutet das oft einen Zwang, Werkzeuge zu nutzen, die sie vielleicht nur begrenzt sinnvoll finden oder bei denen Unsicherheit hinsichtlich Datenschutz, Urheberrecht oder ethischer Aspekte besteht. Eine humanistische und pragmatische Perspektive würde hingegen vorschlagen, KI als unterstützendes Werkzeug verfügbar zu machen und deren Nutzung freiwillig und situationsabhängig zu gestalten. Unternehmen könnten in einem solchen Szenario breit erproben, welche KI-Tools für welche Aufgaben geeignet sind und die Mitarbeiter in die Auswahl und Verbesserung dieser Technologien aktiv einbinden. Diese offene und flexible Herangehensweise wirkt in der Praxis deutlich nachhaltiger und respektvoller gegenüber der Expertise und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden.
Darüber hinaus adressiert sie wichtige Fragen der IT-Sicherheit, der Datenhoheit und der Compliance. Neben der Unternehmenspolitik spielt auch die Verbreitung der KI-Technologie außerhalb der Unternehmen eine Rolle. Viele Einzelpersonen und Teams probieren KI-Werkzeuge bereits aus Neugier oder Notwendigkeit, ohne Vorgaben von oben. Dies führt zu einer organischen Verbreitung von Innovationen, welche die wirklichen Anwendungsfälle besser reflektiert als eine starre Einführung durch Management. Eine differenzierte Sicht auf Technologie beschreibt auch technologische Optimisten, die selbst entwickeln oder mit Communities zusammenarbeiten.
Sie betonen, dass echte Fortschritte ruhig und methodisch vorangetrieben werden sollten, statt durch Hype und Pflichtvorgaben. Sie sehen in KI eine Ergänzung, aber nicht die Alleinlösung für Produktivität oder Innovation. Deswegen wirkt die „AI-first“-Strategie häufig eher als eine politische Demonstration von Führungsstärke oder als Zeichen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Unternehmenskultur denn als eine durchdachte Technologiepolitik. Sie geht mit einer Kultur der Unsicherheit und des Kontrollbedürfnisses einher, welche die Kraft von Zusammenarbeit und Vertrauen untergräbt. Langfristig könnten Unternehmen, die den Mitarbeitenden zu wenig Entscheidungsfreiheit einräumen, Innovationen und Motivation riskieren.
Führungskräfte sollten sich darauf konzentrieren, eine gesunde Balance zwischen dem Nutzen neuer Technologien und menschlicher Kompetenz zu finden. KI sollte ein Werkzeug sein, kein Zwang. Erfolgreiche Unternehmen werden ihre Mitarbeitenden darin ermutigen, KI sinnvoll einzusetzen, Feedback einzuholen und gemeinsam an der Weiterentwicklung zu arbeiten. So wird die Technologie tatsächlich zum Katalysator für bessere Arbeit und nicht zum Maßstab für Kontrollverlust. "AI-first" ist also weniger eine technologische Revolution als eine Kulturfrage.
Wer diesen Trend versteht, erkennt, dass es letztlich darum geht, wie Unternehmen mit Vertrauen, Autonomie und Kollaboration umgehen. Nur wer diese Werte lebt, kann die Chancen der KI sinnvoll nutzen. In der heutigen digitalen Welt bedeutet das, kluge Entscheidungen über Technologie-Einsatz und Unternehmenskultur zu treffen und nicht blind jedem Trend hinterherzulaufen. Dies ist der Schlüssel, damit sich „AI-first“ nicht als Modetrend verläuft, sondern als echter Fortschritt für Arbeit und Gesellschaft festigt.