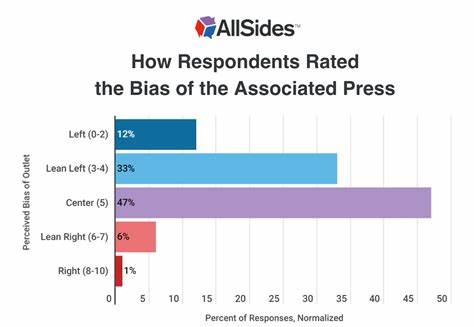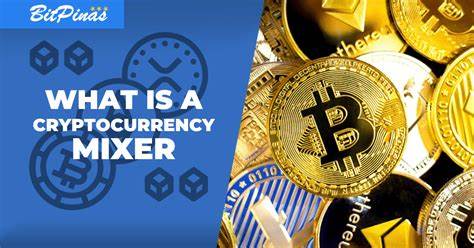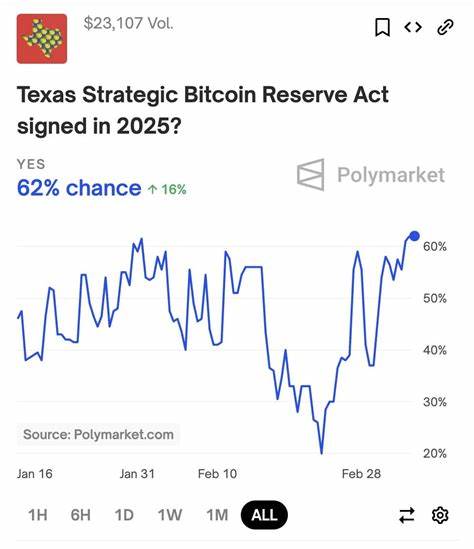Die Kernenergie galt lange Zeit als verheißungsvolle Lösung zur Energieversorgung der Zukunft. Sauber, zuverlässig und in der Lage, große Mengen an Strom ohne CO2-Emissionen zu produzieren – so stellte sich die Technologie viele Jahrzehnte dar. Doch trotz dieser Potenziale hat sich die kommerzielle Nutzung der Kernkraft in vielen westlichen Ländern als teuer und kompliziert erwiesen. Ein wesentlicher Grund hierfür liegt weniger in der technischen Machbarkeit als in regulatorischen Beschränkungen, die auf einer mittlerweile umstrittenen wissenschaftlichen Grundlage beruhen. Im Mittelpunkt dieser Debatte stehen die Lineare-No-Threshold-Theorie (LNT) und das daraus abgeleitete Prinzip ALARA, also die Forderung, Strahlenexposition „so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar“ zu halten.
Doch diese Prinzipien sind höchst umstritten – und ihre Auswirkungen auf die Kostenstruktur der Kernenergie immens. Die Wurzeln von LNT führen zurück auf die Forschung des Wissenschaftlers Hermann Muller aus den 1920er- und 1930er-Jahren. Durch Experimente mit Fruchtfliegen bewies er, dass Röntgenstrahlung genetische Mutationen auslöst, die vererbbar sind und oft tödlich wirken. Basierend auf diesen Erkenntnissen postulierte er, dass es keinen sicheren Schwellenwert für Strahlenbelastung gibt. Jede noch so geringe Dosis ionisierender Strahlung erhöhe die Krebswahrscheinlichkeit kumulativ – egal ob in kurzen, hohen oder langen, niedrigen Dosen verabreicht.
Diese Annahme, die linear und ohne Schwellenwert Schäden annimmt, entwickelte sich zur global akzeptierten LNT-Theorie. Während diese Theorie für Großdosen bei atomarer Strahlenbelastung und medizinischen Anwendungen sicherlich ihre Berechtigung hat, wird ihre Annahme einer additiven Schädigung bei niedrigen Dosen zunehmend infrage gestellt. Wenn man das Modell mechanisch auf alle Strahlenexpositionen anwendet, führt das dazu, dass schon minimale Dosen, die nicht messbar gesundheitsschädlich sind, als gefährlich interpretiert werden. Dies widerspricht natürlicher biologischer Reparaturmechanismen, die unser Körper besitzt. Die DNA-Reparaturfähigkeiten, die ab den 1950er-Jahren intensiv erforscht wurden, zeigen, dass Zellen auch Schäden durch Strahlung bis zu einem gewissen Grad ausgleichen können.
Es ist vergleichbar mit einem Körper, der sich von kleinen Verletzungen täglich regeneriert – der Schaden addiert sich nicht unbegrenzt. Die Übertragung der LNT-Theorie in die globale Strahlenschutzregulierung führte zum Prinzip ALARA. Ziel dieser Richtlinie ist es, jede Strahlenbelastung so gering wie praktisch möglich zu halten, ungeachtet der tatsächlichen gesundheitlichen Risiken. Diese Nulltoleranzpolitik hat zwar ihren guten Grund im vorbeugenden Schutz der öffentlichen Gesundheit, doch wird sie zunehmend als irrational und kostentreibend kritisiert. Während die vernachlässigbaren Gesundheitsvorteile teilweise argumentativ hergeleitet werden, explodieren durch das Festhalten an ALARA die Bau- und Betriebskosten von Kernkraftwerken.
Ein anschauliches Beispiel liefert das Genehmigungsverfahren für drei fortschrittliche Siedewasserreaktoren, die GE Hitachi in Wales errichten möchte. Obwohl das zugrundeliegende Reaktordesign nachweislich sicher und schon in Japan erprobt wurde, verlangte die britische Sicherheitsbehörde komplexe technologische Modifikationen, um Strahlenemissionen um winzige Bruchteile von Millisieverts pro Jahr zu verringern. Diese Reduzierung entspricht in etwa der Strahlenbelastung durch den Verzehr einer einzigen Banane – eine natürliche Quelle von Radioaktivität. Solche Anpassungen bedeuten jedoch erhebliche Umplanungen, kostspielige Filterinstallationen und aufwändige bauliche Veränderungen, die die Gesamtkosten eines Projekts in die Höhe treiben. Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind gravierend.
In den 1970er- und 1980er-Jahren haben verschärfte Regulierungsvorgaben, die unter anderem durch ALARA getrieben wurden, die Baukosten für Kernkraftwerke in den USA um mehr als 170 Prozent erhöht. Zeitverzögerungen infolge zusätzlicher Sicherheitsprüfungen führten sogar zur Insolvenz von Unternehmen, die große Kernanlagen errichten wollten. Selbst nach Jahrzehnten ist dieser Trend kaum gebrochen. Jedes neue Sicherheits- oder Umweltgutachten fordert weitere Maßnahmen, zusätzliche technische Absicherungen und eine aufwendigere Dokumentation – all dies schlägt sich direkt in den Kosten nieder und erschwert Investitionen. Die grundsätzliche Kritik an LNT wird durch Epidemiologiestudien untermauert, die keinen klaren statistischen Zusammenhang zwischen niedriger Strahlenbelastung und erhöhtem Krebsrisiko nachweisen können.
Nutzen aus langfristigen Beobachtungen von Beschäftigten in kerntechnischen Anlagen sowie Anwohnern von Gebieten mit natürlicher Strahlenbelastung wie Kerala in Indien zeigen keine signifikante Erhöhung der Krankheitsraten. In einigen Fällen lassen sich sogar Hinweise auf eine leichte Schutzwirkung vermuten, wohlmöglich ausgelöst durch die Aktivierung von Reparaturmechanismen im Körper. Trotzdem bleiben die wissenschaftlichen Gremien zurückhaltend bei einer Revision des LNT-Modells – zu groß ist die Unsicherheit und das politisch-wirtschaftliche Risiko, konventionelle Sicherheitsstandards aufzugeben. Faktoren wie das schwer zu widerlegende Vorsorgeprinzip und die institutionelle Trägheit spielen hierbei eine Rolle. Denn obwohl die Theorie selbst bei vielen Wissenschaftlern und Fachleuten in Frage gestellt wird, haftet dem LNT-Ansatz eine gewisse Unantastbarkeit an.
Er dient als klar definierte Regelgrundlage für Regulierungsbehörden, Gerichte und Betreiber und minimiert damit Rechtssicherheitsrisiken. Zudem müssen die Betreiber bei minimalen Expositionsüberschreitungen mit umfangreichen Nachweisen und Sanktionen rechnen, weswegen sie kaum Anreize haben, die wissenschaftliche Debatte offensiv zu führen. Die Kostenexplosion bei Kernkraft ist somit auch als Symptom einer übermäßig konservativen und auf fragwürdiger Wissenschaft basierenden Regulierungsmentalität zu verstehen. Die Investitionen in neue Reaktortechnologien, die vielversprechend für die Dekarbonisierung sind, steigen aufgrund regulatorischer Vorbehalte und Zusatzanforderungen stark an. Die als notwendig verkauften Auflagen erschweren die schnelle und kosteneffiziente Realisierung von Projekten und führen am Ende zu höheren Stromkosten und langfristig zu einem Image- und Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Energiequellen.
Die politische und regulatorische Landschaft zeigt inzwischen erste Risse. So hat beispielsweise die US-Administration im Mai 2025 öffentlich gemahnt, das LNT-Modell und das ALARA-Prinzip zu überdenken und die eigene Praxis der Strahlenschutzregulierung kritisch zu reflektieren. Kritiker wie der Experte Jack Devanney fordern seit Jahren umfassende Reformen und argumentieren, dass eine wissenschaftlich fundierte Neubewertung der Strahlenrisiken die Kernenergie wesentlich konkurrenzfähiger machen würde. Vor allem vor dem Hintergrund der globalen Energiekrise und der dringenden Notwendigkeit der Energiewende ist die Debatte von enormer Bedeutung. Kernkraft kann eine sichere, emissionsarme Brückentechnologie sein, die auch Versorgungssicherheit garantiert.
Doch solange die Regulierung durch LNT und ALARA unverändert preskriptiv bleibt, werden Kernkraftprojekte mit immensem bürokratischem Aufwand verbunden sein. Die Folge sind hohe Baukosten, teure Laufzeitverlängerungen, zögerliche Investitionen und ein verlangsamter Ausbau, der dem Klimaschutz im Weg steht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die wissenschaftliche Grundlage, auf der ein Großteil der Kernenergie-Überregulierung fußt, inzwischen angezweifelt werden muss. Das starre Festhalten an der Linear-No-Threshold-Hypothese und der daraus resultierenden ALARA-Politik führt zu erheblichen Mehrkosten, die ohne nachweisbaren Nutzen für die Sicherheit der Bevölkerung entstehen. Damit wird die Kernenergie unnötig verteuert und ihre Rolle als wichtigen Baustein einer nachhaltigen Energiezukunft gefährdet.
Für eine moderne, sachliche und effiziente Energiepolitik ist es deshalb unerlässlich, die Strahlenschutzrichtlinien auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten und praktikablere, risikobasierte Ansätze zu entwickeln, die Sicherheit gewährleisten ohne Innovation im Keim zu ersticken.