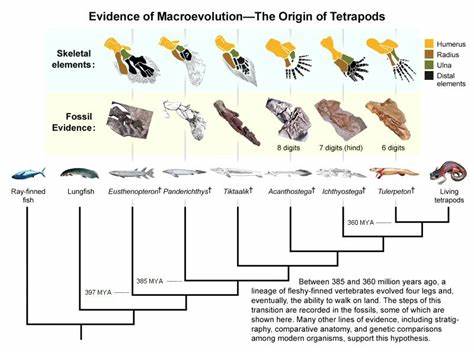Seit der Einführung von ChatGPT und vergleichbaren KI-Chatbots vor etwas mehr als zwei Jahren hat sich die Technologie rasch in zahlreichen Unternehmensbereichen etabliert. Viele Beobachter und Experten prognostizierten einen Wandel der Arbeitswelt von Grund auf – von der Automatisierung einfacher Aufgaben bis hin zur signifikanten Steigerung der Produktivität und potenziellen Lohnerhöhungen für die Nutzer solcher Technologien. Doch die aktuell vorliegende Studie des National Bureau of Economic Research, die über 7.000 Arbeitsplätze in Dänemark untersucht hat, wirft ein überraschendes Licht auf diese Entwicklung. Entgegen weit verbreiteten Erwartungen findet sich bisher kein signifikanter Einfluss der KI-Chatbots auf die tatsächliche Arbeitszeit oder das Einkommen der Beschäftigten, und zwar quer durch unterschiedliche Branchen und Berufsfelder.
Die Forscher um Anders Humlum von der University of Chicago und Emilie Vestergaard von der Universität Kopenhagen analysierten Daten von 25.000 Mitarbeitern in Bereichen, die als besonders anfällig für KI-gestützte Veränderungen gelten. Dazu zählen Berufe wie Buchhalter, Kundenbetreuer, Finanzberater, Personalverantwortliche, IT-Support, Journalisten, Juristen, Marketingexperten, Bürokräfte, Softwareentwickler und Lehrer. Aufgrund der detaillierten Erfassung von Arbeitszeit und Lohnabrechnungen in Dänemark war es möglich, eine aussagekräftige Verbindung zwischen KI-Nutzung und wirtschaftlichen Auswirkungen herzustellen. Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, dass trotz der raschen Verbreitung von KI-Chatbots und der massiven Investitionen von Unternehmen in diese Technologie die tatsächlichen Effekte auf den Arbeitsalltag der Beschäftigten marginal sind.
Durchschnittlich konnten Nutzer von KI-Chatbots lediglich eine Zeitersparnis von rund drei Prozent verzeichnen. Die Produktivitätsgewinne, die sich daraus ergeben, führen dagegen nur in geringem Maße zu höheren Gehältern – lediglich zwischen drei und sieben Prozent dieser Effizienzsteigerung wird an die Beschäftigten weitergegeben. Diese Erkenntnisse zeigen, dass die Verheißungen einer tiefgreifenden Veränderung der Arbeitswelt durch KI derzeit noch nicht eingetreten sind. Es hat weder eine breite Verdrängung von menschlicher Arbeit stattgefunden noch eine signifikante Verbesserung der Lohnaussichten für die sogenannten „KI-Superarbeiter“. Vielmehr verweilt der tatsächliche Nutzen für Mitarbeitende bislang auf einem bescheidenen Niveau.
Dies überrascht umso mehr vor dem Hintergrund aggressiver KI-Adoption in Unternehmen. So setzen etwa Unternehmen wie Duolingo KI ein, um Vertragspartner durch Automatisierung zu ersetzen, während andere Firmen wie Shopify eine Doppelstrategie verfolgen, bei der KI den Vorrang hat und menschliche Mitarbeiter nur als nachgeordnete Alternative eingestellt werden sollen. Gleichzeitig steigen die Aktienkurse von Unternehmen im KI-Bereich, was die Erwartungen an eine revolutionäre wirtschaftliche Umgestaltung befeuert. Die Studie unterstreicht, dass diese Hoffnungen bisher vor allem spekulativer Natur sind und dass die tatsächliche Umwälzung der Arbeitswelt wohl noch Zeit benötigen wird. Die geringe Zeitersparnis von etwa drei Prozent könnte daran liegen, dass trotz der Verfügbarkeit von KI-Tools viele Aufgaben nach wie vor menschliches Urteil und Kreativität erfordern.
AI-Chatbots helfen zumeist bei der Beschleunigung bestimmter Arbeitsschritte wie Recherche, Textverarbeitung oder Datenverarbeitung, können aber komplexe Problemlösung oder strategische Entscheidungen momentan nicht vollständig ersetzen. Auch die niedrige Weitergabe von Produktivitätsgewinnen an Löhne könnte durch unterschiedliche Faktoren erklärt werden. Unternehmen könnten die Effizienzsteigerungen zunächst für andere Zwecke nutzen – für Investitionen, Gewinnmaximierung oder Risikopuffer –, anstatt unmittelbar die Gehälter zu erhöhen. Zudem sind in vielen Branchen Tarifvereinbarungen, Arbeitsverträge und lokale Marktmechanismen wichtige Größen, die die unmittelbare Anpassung von Löhnen an technologische Fortschritte verzögern oder abschwächen. Interessant ist zudem, dass trotz KI-Einsatz bislang keine Massenentlassungen stattgefunden haben.
Dies spricht dafür, dass KI eher als ergänzendes Werkzeug denn als vollständiger Ersatz menschlicher Arbeitskraft gesehen wird. Damit verbunden bleiben die Rollen und Aufgaben von Beschäftigten weiterhin relevant und erfordern in vielen Fällen eine Interaktion mit und Überwachung von KI-Systemen. Gleichzeitig gibt es auch Faktoren, die das volle Potenzial von KI-Anwendungen im Arbeitskontext behindern. Dazu zählen mangelnde Schulung, das Fehlen von Schnittstellen, Datenschutzbedenken und technische Restriktionen. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, KI sinnvoll zu integrieren, die Nutzerakzeptanz zu fördern und Prozesse anzupassen, um produktive Synergien zu schaffen.
Die Ergebnisse der Studie sollten ebenso als realistische Darstellung der aktuellen Situation im Umgang mit KI verstanden werden. In Zeiten großer Medienaufmerksamkeit und Hype ist es wichtig, zwischen technologischen Möglichkeiten und realwirtschaftlichen Effekten zu unterscheiden. Für Arbeitnehmer bedeutet dies, dass KI-Tools zwar unterstützend wirken, aber keine unmittelbare Garantie für besseren Verdienst oder weniger Arbeitszeit darstellen. Gleichzeitig erfahren Arbeitgeber, dass Investments in KI-Technologie geduldig und strategisch geplant werden müssen, um nachhaltige Effizienzgewinne zu erzeugen. Für die Zukunft wird erwartet, dass die KI-Entwicklung weiter voranschreitet und die Einsatzgebiete sukzessive ausgebaut werden.
Mit wachsender Erfahrung und technologischen Verbesserungen könnten Produktivitätsgewinne steigen und mit der Zeit auch stärker an die Beschäftigten weitergegeben werden. Ferner könnte eine veränderte Arbeitskultur so gestaltet werden, dass KI eine produktivere Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine ermöglicht statt nur Unterstützung zu bieten. Insgesamt zeigt die aktuelle Untersuchung, dass die KI-Revolution in der Arbeitswelt zwar im Gang ist, aber noch am Anfang steht. Trotz der rasanten Verbreitung von KI-Chatbots sind tiefgreifende Veränderungen in Arbeitszeit und Einkommen bisher nicht erkennbar. Während sich Unternehmen und Arbeitnehmer auf den weiteren Wandel vorbereiten, gilt es, die Entwicklung realistisch und differenziert zu bewerten und technologische Chancen mit wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen.
Nur so lassen sich die Potenziale der KI sinnvoll nutzen, ohne die Erwartungen und Hoffnungen voreilig zu überhöhen.