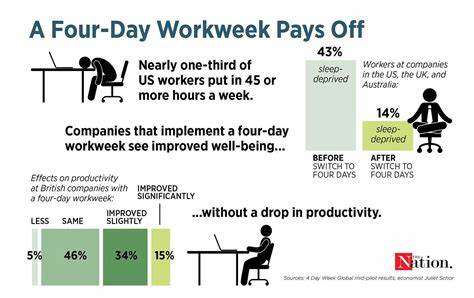Die Vereinigten Staaten von Amerika haben angekündigt, die Vergabe von Visa an ausländische Beamte zu verweigern, die aktiv die Verbreitung amerikanischer Inhalte auf Social-Media-Plattformen blockieren oder zensieren. Diese neue Maßnahme stellt eine klare Antwort auf sogenannte „Flagrante Zensurmaßnahmen“ dar, mit denen ausländische Regierungen oder Behörden amerikanische Social-Media-Anbieter wie Twitter (heute unter dem Namen X), Facebook und andere daran hindern, freie Meinungsäußerung zu ermöglichen. Die Entscheidung signalisiert zudem das anhaltende Bestreben der USA, ihre digitale Souveränität zu schützen und die globale Debatte um Meinungsfreiheit und Zensur kritisch zu beeinflussen. Die US-Regierung sieht diese Art der Zensur als unakzeptablen Eingriff in die Freiheitsrechte amerikanischer Bürger und aller Nutzer der US-Plattformen weltweit. Diese Haltung wurde insbesondere durch das Engagement von Marco Rubio, dem US-Außenminister, der sich vehement gegen die Einschränkungen ausspricht, die andere Regierungen über ihre Sozialen Medien auferlegen, gestärkt.
Mit dieser Praxis greift man laut offiziellem Statement in die Grundrechte von US-Bürgern sowie in die Funktionsweise amerikanischer Technologieunternehmen ein. Eine Verweigerung oder Erschwerung der Visavergabe an Beamte, die aktiv solche Maßnahmen umsetzen, ist die Folge. Auslöser für diese Verschärfung sind konkrete Fälle, in denen offizielle Instanzen ausländischer Länder US-Bürger zur Verantwortung gezogen oder sogar mit Strafverfolgung bedroht haben, nur weil sie auf US-Plattformen freie Meinungsäußerung praktizierten. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Äußerungen politisch oder gesellschaftlich kontrovers waren; der zentrale Streitpunkt ist das Prinzip der Meinungsfreiheit auf US-amerikanischem digitalen Terrain. Besonders umstritten sind Fälle, in denen angeblich „verbotene“ Inhalte in sozialen Netzwerken von US-Bürgern auch im Ausland verfolgt werden.
Die US-Regierung betont, dass außeramerikanische Akteure keine rechtliche Autorität haben, auf US-Bürger und ihre digitalen Aktivitäten direkt Einfluss zu nehmen. Ein prominentes Beispiel ist das Vorgehen gegen den brasilianischen Obersten Gerichtshof, dessen Präsident, Alexandre de Moraes, wiederholt als Ziel möglicher Sanktionen genannt wurde. Der brasilianische Richter hatte mehrfach Verfügungen gegen Plattformen wie X (früher Twitter) erlassen und die Blockierung von Accounts angeordnet, die angeblich Desinformationen verbreiten. Diese Entscheidungen führten zu Spannungen, da der US-Bundesstaat diesen Eingriff als Einschränkung der Meinungsfreiheit und als eine Form der „Zensur über die nationale Souveränität hinaus“ bewertet. Parallel dazu kritisiert die US-Regierung auch andere westliche Länder wie Deutschland und Großbritannien für deren rigorose Regulierungen von Online-Inhalten, insbesondere im Bereich der Bekämpfung von Hate Speech und Desinformation.
Diese Gesetze und Verordnungen, so die Offiziellen, könnten als Formen von Zensur betrachtet werden, die ebenfalls amerikanische Rechte in den digitalen Medien beeinflussen würden. Deutschland weist dabei auf seine historische Verantwortung hin, um Rechtsextremismus und Hassrede rigoros zu unterbinden, was in den USA kontrovers diskutiert wird. Die Debatte offenbart einen tiefen ideologischen Graben zwischen dem Verständnis von freier Rede als einer fast absolut gewährten Freiheit in den USA und der europäischen Haltung, die mehr auf Schutz vor gesellschaftlichen Schäden durch Hassrede setzt. Der Kontext der neuen US-Politik ist eng mit innenpolitischen Entwicklungen verbunden. Seit dem Ausschluss von Donald Trump von Plattformen wie Twitter und Facebook im Anschluss an die Ereignisse am 6.
Januar 2021 – dem Sturm auf das US-Kapitol – haben sich viele konservative Stimmen in den USA gegen die wachsende Regulierung und Zensur geäußert. Trumps Anhänger sehen darin eine politische Motivierung zur Einschränkung konservativer Meinungen im Internet. Die jetzige Administration unterstreicht, dass sie nicht bereit ist, die Freiheit amerikanischer Bürger auf sozialen Plattformen preiszugeben, selbst wenn dies zu internationalen Konfrontationen führt. Die restriktivere Visapolitik betrifft nicht nur Regierungen, sondern hat auch Auswirkungen auf internationale Studierende in den USA. Marco Rubio hat bereits in der Vergangenheit Visa für Tausende ausländischer Studierender widerrufen, die im Zusammenhang mit Protesten gegen Israels Militäroperationen im Gazastreifen standen.
Die verschärfte Überprüfung von Sozialen Medien bei Visaanträgen soll dazu beitragen, potenzielle „umstrittene“ politische Aktivitäten frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu regulieren. Ein bekanntes Einzelfallbeispiel ist die türkische Doktorandin Rümeysa Öztürk von der Tufts University, die wegen ihrer kritischen Äußerungen zu Deutschlands Position im Gazakonflikt von Behörden abgeführt und in Gewahrsam genommen wurde, später jedoch von einem Richter freigelassen wurde. Der Fall hat weltweite Aufmerksamkeit erregt und verdeutlicht, wie komplex und heikel die Schnittstellen von Meinungspolitik, internationalen Rechtsnormen und Migration geworden sind. Die USA sehen ihre digitale Souveränität zudem als unverhandelbares Gut an. Die Einmischung ausländischer Beamter oder Regierungen in die Moderation amerikanischer Social-Media-Plattformen wird als eine Bedrohung der nationalen Unabhängigkeit und der demokratischen Grundwerte verstanden.
Die Vereinigten Staaten wollen deshalb klarstellen, dass Zensurmaßnahmen, die außerhalb ihrer Grenzen bestimmte Inhalte verbieten, nicht akzeptiert werden, wenn sie amerikanische Nutzer einschränken oder amerikanische Plattformen dazu zwingen, ihre Inhalte global zu regulieren. Diese Haltung hat auch geopolitische Dimensionen. Die USA stehen im digitalen Kalten Krieg mit anderen globalen Mächten, die ihre eigenen Internetnormen etablieren wollen. Länder wie China oder Russland verfolgen andere Modelle der Internetkontrolle, die nicht mit dem liberalen Ansatz der Vereinigten Staaten vereinbar sind. Die Maßnahme zur Visaverweigerung ist auch Ausdruck dieser strategischen Auseinandersetzung, um Einfluss auf den Fluss von Informationen und den Umgang mit digitalen Freiheiten auszuüben.





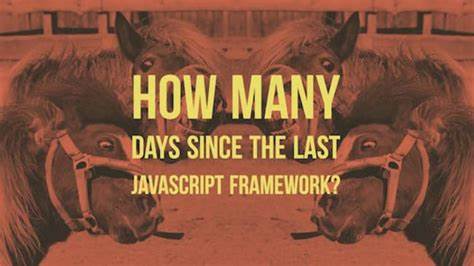
![Sun Ray Thin Clients Pt1: Hotdesking [video]](/images/7D3F7916-9388-434F-9DE1-781C20F4F7C6)